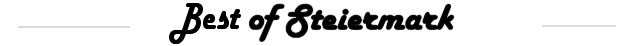Burgau (Steiermark)
Burgau ist eine Marktgemeinde mit 1090 Einwohnern (Stand 1. Jänner 2024) im politischen Bezirk Hartberg-Fürstenfeld in der Steiermark. Bekannt ist Burgau für das Wasserschloss sowie die Wallfahrtskirche Maria Gnadenbrunn.
Geografie: Die Grenze im Osten bildet die Lafnitz, deren Tal rund 220 Meter über dem Meer liegt. Nach Westen steigt das Land zum Galgenwald und zum Entenwald auf 350 Meter an.
Die Gemeinde hat eine Fläche von 20,0 Quadratkilometer. Davon sind 38 Prozent landwirtschaftliche Nutzfläche und 53 Prozent sind bewaldet.
Gliederung: Es existieren außer Burgau keine weiteren Katastralgemeinden.
Nachbargemeinden:
Neudau,
Burgauberg-Neudauberg,
Bad Waltersdorf,
Deutsch Kaltenbrunn und
Bad Blumau.
Geschichte: Das ursprünglich mit einem breiten Wassergraben befestigte Schloss war eine strategisch wichtige Grenzfestung gegen die Bedrohungen aus dem Osten und erhielt zusätzlichen Schutz durch die beiden Flüsse Lafnitz und Loben. Bis in das 12. Jahrhundert gibt es keine Quellen, die auf die Herrschaft Burgau Bezug nehmen. Das ehemalige Wasserschloss „Burg in der Au“ wird erst 1367 unter der Herrschaft der Herren von Puchheim (Adelsgeschlecht), die Burgau als landesfürstliches Lehen besaßen, urkundlich erwähnt. Der später zu einem Türkeneinfall umgedichtete Ungarneinfall von 1418 zog auch Burgau in Mitleidenschaft.
1429 gingen Markt und Feste Burgau als landesfürstliches Lehen an das Geschlecht der Herren von Neitperg (Burg Neuberg). Hans von Neitperg war der letzte seines Namens und Stammes, nach dessen Tod das Lehen durch die Herren von Polheim übernommen wurde. Die Polheimer verwalteten ihre Güter von Seggauberg (bei Leibnitz) aus. In dieser Zeit wurde Burgau den Vernichtungszügen der Söldner des Andreas Baumkircher ausgesetzt, die nach der verlorenen Schlacht bei Fürstenfeld und der Hinrichtung ihres Anführers 1471 die Oststeiermark und damit auch Burgau bis 1475 devastierten. Mit der Unterstützung Weikhard von Polheims ging die Bevölkerung daran, den Ort und die Kirche, in der sich das Epitaph Weikhards befindet, wieder aufzubauen. Fünf Jahre nach dem Tod Weikhards im Jahre 1489 empfing sein Sohn Seifried für sich und seinen Bruder, die beide in Linz ansässig waren, von Friedrich III. die Herrschaft Burgau als Lehen. Trotz der Verhandlungen mit Ungarn, die sie vor weiteren Einfällen bewahrten, geriet Seifried von Polheim in große finanzielle Schwierigkeiten und musste aufgrund von Zahlungsunfähigkeit das Schloss im November 1498 um 200 Gulden verpfänden. Im Jahre 1500 bekam Erhard von Polheim wegen seiner Tapferkeit gegen die Türken die Herrschaft Burgau nun als freies Eigen geschenkt und ging sofort daran, die Befestigungsanlagen der Burg auszubauen. So konnten die Türken 1529 und 1532 erfolgreich abgewehrt werden. Allerdings wurden zahlreiche Burgauer von den Türken, die in diesem Jahr auch Wien zum ersten Mal belagerten, verschleppt und getötet.
Ab 1530 verwaltete Weikhart von Polheim für seinen Vater Erhard die Herrschaft, ab 1538 folgte er ihm im Besitz. Ebenfalls von Geldsorgen geplagt, veranlasste er den Umbau der Burg und ließ den Bergfried abtragen, die Wehrmauern verstärken, die nun die Vorburg mit dem Wohnschloss verbanden, an der Südfront der Vorburg zwei neue Wehrtürme errichten und einen Wassergraben anlegen. Das Torhaus wurde nun durch eine Zugbrücke verschlossen, eine Holzbrücke überspannte den Wehrgraben. Damals erhielt der Wehrbau sein endgültiges Aussehen. Das Schloss Burgau war somit zu einem großen Wasserschloss ausgebaut. Nach dem Tode Weikhards von Polheim 1550 verwaltete sein Bruder Hans das Schloss für seinen Sohn Wigolens.
1559 und 1564 musste die verschuldete Herrschaft Burgau verpfändet werden, die noch im darauffolgenden Jahr als Erbe an Hans von Zelking fiel, der sie an Mathias von Trauttmannsdorff verkaufte, dessen Familie durch hohe Abgaben des Robots (Frondienst) die Bevölkerung unter Druck setzte. Ein Gesuch der Bürger von Burgau um Robotbefreiung aus dem Jahre 1675 bzw. 1687 wurde von der innerösterreichischen Regierung abgewiesen. An diese Besitzperiode erinnert ein Inschriftstein, der mit dem Trauttmannsdorffschen Wappen über dem Eingangsportal folgende Worte trägt: „Maximilian Graf von Trautmannsdorf und Weinsberg, Ritter des goldenen Vlies, Röm. Kais. Majestät Ferdinand III. geheimer Rath, Kämmerer und Obersthofmeister“.
Im Jahre 1704 fielen die Kuruzen, rebellische Gegner der habsburgischen Herrschaftsansprüche, in dieses Gebiet ein und weite Teile der Oststeiermark wurden verwüstet. Dass Burgau wie durch ein Wunder von diesen Attacken zum Großteil verschont blieb, ist nur auf die geschickte Verhandlungstaktik des Burgauer Bürgermeisters zurückzuführen, der den Rebellen Waren und Münzen als Lösegeld angeboten hatte. Max Gundakher Graf von Trauttmannsdorff, der schon 1749 einen Teil des Besitzes von seinem Vater übernommen hatte, verkaufte 1753 diesen schließlich an den aus ungarischem Adel stammenden Grafen Adam III. Batthyány, dessen Familie zu den bedeutendsten Besitzern der Herrschaft Burgau zählt.
Dessen Sohn und Nachfolger, Karl II. Graf Batthyány (1742–1814) war kaiserlicher Botschafter in London. Er war von der rein maschinell arbeitenden neuen Spinntechnik in England überzeugt und hatte zwei Baumwollstreckmaschinen und eine Spinnmaschine aus England herausschmuggeln und nach Burgau transportieren lassen, wo er 1789 die erste Baumwollspinnerei der Habsburgermonarchie gründete und so wesentlich zur Schaffung von Arbeitsplätzen für die einheimische Bevölkerung beitrug. Später wurde für die Arbeiter der Spinnfabrik sogar eine eigene Arbeitersiedlung, der sogenannte „Untere Markt“, errichtet. Schwierigkeiten mit der Rohstoffbeschaffung, zunehmende Konkurrenz aus dem Wiener Raum und die Franzosenkriege führten 1808 zu einer zeitweiligen Schließung der Fabrik.
1831 erwarb der Wiener Garngroßhändler Georg Borckenstein (1787–1863) die Fabriksanlagen und erweiterte und modernisierte sie, sodass vier Jahre später die Produktion wieder aufgenommen werden konnte. 1843 erfolgte eine Expansion des Betriebs ins benachbarte Neudau: Eine Erweiterung in Burgau wurde vom Gemeinderat abgelehnt, weil die damit verbundenen Soziallasten damals von der Gemeinde zu tragen waren. Im Laufe des 20. Jahrhunderts wurde der Betrieb dann vollständig nach Neudau verlagert und 1987 wurden die alten Fabriksgebäude in Burgau geschleift und Wiesen angelegt. Die ab 1853 „G. Borckenstein und Sohn“ genannte Firma fusionierte 1979 mit ihrem Miteigentümer „Seutter & Co.“ Zuletzt (2019) hieß die Firma „Borckenstein GmbH“.
In Burgau befand sich nicht nur die älteste Textilfabrik der Donaumonarchie, auch andere technische Errungenschaften lassen sich hier schon früh nachweisen. So beschaffte Graf Carl Batthyány auch eine moderne Dreschmaschine aus England; bereits 1884 wurde Burgau durch die Lokalbahn Bierbaum–Neudau an das Eisenbahnnetz angeschlossen und im Jahre 1909 wurde hier durch den k.u.k. Hauptmann Johann Svetits ein Elektrizitätswerk erbaut.
Der letzte Besitzer von Schloss Burgau, Graf Lajos Batthyány, Nachfolger von Graf Carl Batthyány, wurde als Ministerpräsident und Anführer der Märzrevolution in Ungarn verhaftet und im Oktober 1849 hingerichtet. In Gedenken an ihn wurde im Oktober 1999 zum 150. Todestag eine Batthyány-Büste und Gedenktafel im Schlosshof angebracht.
Seit 1871 ist das Schloss im Besitz der Marktgemeinde Burgau. Bis 1968 war die Volksschule im Schloss untergebracht. 1990 richtete Ryke Geerd Hamer dort ein Zentrum für Neue Medizin ein, das 1995 behördlich geschlossen wurde.
In den letzten Jahren wurden das Schloss, der Innenhof und die Vorburg mit Rundturm restauriert. Der Rundturm beherbergt das Gemeindeamt und ein Schlosscafé, in der Vorburg (ehemaliger Bedienstetentrakt) befinden sich Wohnungen. Der Keller des Hauptschlosses zeigt ein schönes Ziegelgewölbe und wird für Veranstaltungen genutzt. Der Festsaal im zweiten Stock des Schlosses sowie der Innenhof mit den Arkadengewölben wird für kulturelle Veranstaltungen genutzt. (Ausstellungen, Konzerte, Theateraufführungen, Hochzeiten, Kongresse …)
1998 wurde der Wassergraben auf der Westseite des Schlosses wieder errichtet.
Kultur und Sehenswürdigkeiten:
Angerkreuz: Das Angerkreuz befindet sich am Angerweg in Burgau und wurde Mitte des 18. Jahrhunderts errichtet.
Bildeiche: Zur Erinnerung an einen Viehhändler, der sich mit viel Geld in den Taschen vor Räubern auf eine Eiche gerettet hat.
Brunnen am Hauptplatz: Bei der Erneuerung des Burgauer Ortsbildes wurde am Hauptplatz ein Steinbrunnen errichtet.
Brunnen am Johannesplatz: Der Brunnen befindet sich am Johannesplatz in Burgau.
Denkmal Gottfried Schlegl: Das Denkmal Gottfried Schlegl befindet sich beim Kirchenplatz in Burgau. Die Inschrift lautet: "Errichtet von Berg- und Naturwächter Gottfried Schlegl zum Dank.".
Dreifaltigkeitskapelle: Die Dreifaltigkeitskapelle befindet sich in unmittelbarer Nähe der Pfarrkirche Mariä Geburt und ist unter der Objekt-ID: 725 (HERIS-ID: 4867) denkmalgeschützt.
Ehem. Fabrikantenvilla Borckenstein: Die ehem. Fabrikantenvilla Borckenstein befindet sich an der Parkstraße 70 in Burgau und ist seit 2021 unter der HERIS-ID: 4873 denkmalgeschützt.
Feldkreuz: Für die Bittprozessionen vor Christi Himmelfahrt.
Frühmann-Denkmal: Ein steinernes Denkmal, das an den beim Holzschlagen verunglückten Herrn Julius Frühmann (Wehrführer und Bez. Wehrführer Stellvertreter, † 16.10.1935, Freiw. Feuerwehr und Rettungs-Abteilung Burgau) aus Burgau erinnert.
Galgenkreuz: Bei dem sogenannten Galgenkreuz handelt es sich um einen gemauerten Bildstock mit einer Steinpietà aus dem 16. / 17. Jahrhundert. Sockel mit Engelskopf. Pieta, vor der die zum Tode Verurteilten ihr letztes Gebet verrichteten. Der Galgen war ein dreibeiniges, hölzernes Gestell und stand im sogenannten Galgenwald. Die letzte Hinrichtung erfolgte zu Zeiten Maria-Theresias. Maria Rath wurde zum Tode verurteilt, weil sie ihr Kind tötete. Der Bildstock ist unter der Objekt-ID: 713 (HERIS-ID: 4855) denkmalgeschützt.
Gedenktafel für Lajos Batthyány: Die Gedenktafel für Lajos Batthyány (Inschrift in Ungarisch und Deutsch) befindet sich im Innenhof des Wasserschlosses.
Grabdenkmal Kaler von Lonzenheim: Das Grabdenkmal Kaler von Lonzenheim befindet sich am Friedhof und ist unter Objekt-ID: 724 (HERIS-ID: 4866) denkmalgeschützt.
Grabenackerkreuz: Dieses Feldkreuz wurde im Oktober 2010 durch den ÖAAB-Burgau errichtet und durch Pfarrer Josef Karl Fleck eingeweiht. Das ursprüngliche Kreuz, welches weiter südlicher stand, war nicht mehr instandsetzbar. 1949 wurde das alte Kreuz letztmalig hergerichtet und bei der 1. Bittprozession am 23.5.1949 durch Pfarrer Anton Fink geweiht. Christusschnitzer: Martin Bauer aus Kemeten, Kreuzerbauer: Johannes Wagner aus Burgau.
Grundzusammenlegung bzw. Flurbereinigung: Denkmal zur Grundzusammenlegung Nord 1992-1997 in Burgau. Josef Lederer aus Burgau.
Hl. Johannes Nepomuk: Die Figur des Hl. Johannes Nepomuk befindet sich beim Haus Skulpturen Eder am Johannesplatz 92, direkt bei der Brücke über den Lobenbach.
Kapelle: Die Kapelle befindet sich an der Grenze zwischen Burgau und Neudau.
Köberlpark: Der Köberlpark befindet sich gegenüber dem Wasserschloss in Burgau, direkt neben dem Freibad bzw. dem Schlossbad Burgau. Die Anlage dient als Erholungsort und beinhaltet auch einen Kinderspielplatz.
Kreuz: Das Kreuz aus Holz befindet sich an der Grenze zwischen der Steiermark und dem Burgenland, an der Lafnitz, beim Gasthaus Loatawagerl.
Kriegerdenkmal: Das Soldatendenkmal befindet sich an der Außenwand der Pfarrkirche Maria Gnadenbaum in Burgau in der Steiermark. Es ist geschützt durch ein vorspringendes Dach mit einem Sgrafitti mit Kriegsszenen, darunter befinden sich die Wandplakette mit den Namen der Gefallen und Vermissten aus dem 1. und 2. Weltkrieg.
Lamminger-Marterl: Das Marterl ist einer Frau Lamminger (1901-1921) gewidmet.
Leidensmann-Kapelle: Die Leidensmann-Kapelle befindet sich bei der Fürstenfelder Straße 84 in Burgau und ist unter der Objekt-ID: 729 (HERIS-ID: 4871) denkmalgeschützt. Die Mitte des 18. Jahrhunderts errichtete Leidensmann-Kapelle zeigt Stuckzierat an den Lisenen und hölzerne Skulpturen "Christus an der Geiselsäule" und "Christus in der Wies". Renoviert 1983 und 2009 von der steirischen Frauenbewegung Burgau.
Luther-Kreuz: Zur Erinnerung an den verunglückten Förster Luther, den sein Hund einige Tage bewacht und dann den Suchtrupp zu ihm geführt hat.
Mariazeller Kreuz: Ein Holzkreuz, bei dem die Fußwallfahrer bei der Wanderung nach Mariazell jedes Jahr ihr erstes Gebet verrichten († 1983 †).
Mariazellerplatzl, Fußwallfahrer: Dieser Platz vor der Pfarrkirche Mariä Geburt in Burgau ist ein sichtbares Zeichen der Burgauer Fußwallfahrer und soll einladen zu rasten, Gespräche miteinander und Gespäche mit Gott zu führen. Die Skulptur in der Mitte wurde 2008 von Josef Lederer aus Burgau geschaffen.
Mariensäule am Hauptplatz: Am Burgauer Hauptplatz 9 befindet sich auf einem quadratischen Sockel eine ca. elf Meter hohe Mariensäule. Sie wurde 1750 errichtet und an der Spitze befindet sich eine vergoldete Marienfigur aus der Veit Königer Werkstatt, die nach Osten blickt; zur Erinnerung, aus welcher Richtung die Pest in den Ort kam. Ein Stich des Topographen Georg Matthäus Vischer vom Markt Burgau lässt allerdings vermuten, dass sich eine Säule bereits um 1670 auf dem Hauptplatz befunden hat. Auf der Marmortafel am Fuß der Säule ist auch das Jahr 1778 vermerkt, in dem ein heftiges Unwetter den Ort verwüstete. Bei diesem Unwetter wurde u. a. die Mariensäule umgeworfen und auch der nördliche Turm des Schlosses zerstört. Seit diesem Unwetter ist der Heilige Donatus der Ortspatron von Burgau und ihm zu Ehren wird jedes Jahr am zweiten Sonntag im Juli eine Bittprozession mit anschließendem Pfarrfest abgehalten (Objekt-ID: 708, HERIS-ID: 4850).
Mühlhauser Kapelle: Die Mühlhauser Kapelle befindet sich bei der Fürstenfelder Straße 84 in Burgau und ist unter der Objekt-ID: 729 (HERIS-ID: 4871) denkmalgeschützt. Die Mühlhauser-Kapelle zeigt Stuckzierat an den Lisenen und ein hölzernes Gnadenbild Christus in der Wies, beides aus der Mitte des 18. Jahrhunderts.
Müllnerkreuz: Das Müllnerkreuz befindet sich an der Kreuzung Forsthausweg und Sonnenblumenweg in Burgau.
Ofner-Bildstock: Bildstock der Familie Ofner, zum Dank für die Rückkehr von Peter Ofner aus russischer Gefangenschaft errichtet.
Pfarrkirche Mariä Gnadenbrunn: Die römisch-katholische Pfarrkirche Mariä Geburt steht auf einer Bodenschwelle in freier Lage im Westen des Dorfes in der Gemeinde Burgau im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld in der Steiermark. Die dem Patrozinium Mariä Geburt unterstellte Pfarrkirche gehört zur Region Oststeiermark (Dekanat Waltersdorf) in der Diözese Graz-Seckau. In der Pfarrkirche Burgau findet jedes Jahr von April bis Oktober an jedem 13. Tag des Monats eine Wallfahrt statt. Die Pfarrkirche Mariä Geburt ist unter der Objekt-ID: 732 (HERIS-ID: 4874) denkmalgeschützt.
Pieberkreuz: Das Mitte des 18. Jahrhunderts errichtete Pieberkreuz befindet sich beim Alt-Bürgermeister Weg (Kreuzung Hochstraße und Vorderauweg) in Burgau.
Rotes Kreuz: Das Rote Kreuz befindet sich an der Burgauerstraße (L402), gegenüber dem Spar bzw. Gebrauchtwagen Florian. Es wurde 2002 von der Frauenbewegung Burgau renoviert und erneuert. Die Renovierung des Herrgottes erfolgte im Jahr 2007.
Schwarzes Kreuz: Das Schwarze Kreuz, im Volksmund auch "Pestkreuz" genannt, in Burgau ist ein Bildstock zur Erinnerung an die Pest in Burgau. Tabernakelbildstock Sandsteinfigur "Madonna mit Kind" (gew. d' Altsteirer z' Burgau).
Steinbrunnen: Bei der Erneuerung des Burgauer Ortsbildes wurde am Hauptplatz auch ein Steinbrunnen neu angelegt und um die alte Linde (Naturschutzdenkmal) eine Rundbank aufgestellt.
Schlossbad: Das Strandbad mit einem Naturteich befindet sich direkt neben dem Wasserschloss in Burgau.
Tabaktrockenanlage: Die Tabaktrockenanlage befindet sich gegenüber dem Lobenweg 342 in Burgau und ist unter der Objekt-ID: 722 (HERIS-ID: 4864) denkmalgeschützt.
Tschartake: Anlässlich der Ausstellung Labonca-Lafnitz - Leben an einer der ältesten Grenzen Europas im Jahr 1995, wurde direkt an der Lafnitz ein Grenzwächterhaus, die Tschartake, nachgebaut. Dieses Grenzwächterhaus liegt am sogenannten „Kuruzzenwanderweg". Dieser Wanderweg ist auch gleichzeitig ein Naturlehrpfad, der Schautafeln über die Flora und Fauna im Hügelland, die Bedeutung der Hecken, die Ökologie der Aulandschaft, die Bedeutung der Streuobstwiesen und über die Veränderungen der Landschaft durch Anbau zeigt. Im August 2012 wurden die Tschartake sowie die Brücke über die Lafnitz im Zuge der notwendigen Renovierung komplett erneuert.
Wasserschloss Burgau: Die Burg (Wasserschloss) wurde vermutlich zu Beginn des 14. Jahrhunderts errichtet und bestand ursprünglich nur aus einem von Wassergräben umgebenen Wehrturm. Erhard von Polheim errichtete 1538 die große zweigeschossige Vorburg. Das heutige Aussehen erhielt die Hauptburg 1624 durch einen großzügigen Ausbau. Bei einem Unwetter 1778 wurde der Mittelturm des Schlosses stark beschädigt und daraufhin abgetragen. Seit 1870 ist die Marktgemeinde die Eigentümerin der Burg. Sie nutzt das Gebäude als Gemeindeamt und für Veranstaltungen, in der Vorburg wurden Wohnungen geschaffen. Außerdem erhielt der Innenhof des Schlosses im September 1999 den 4. Tisch einer 5-teiligen Steintischserie, den sogenannten Utopientisch (Objekt-ID: 705, HERIS-ID: 4847).
Ziegelteich-Kreuz: Das hölzerne Kreuz befindet sich beim Ziegelteich.
Arbeitsmarkt, Pendeln: Im Jahr 2011 lebten 431 Erwerbstätige in Burgau. Davon arbeiteten 122 in der Gemeinde, mehr als 70 Prozent pendelten aus.
Städtepartnerschaft: Bereits seit Mitte der 1970er Jahre bestehen Kontakte zur Markgrafenstadt Burgau in Bayern. Offiziell besiegelt wurde die Partnerschaft im Jahr 1982.
Wappen: Blasonierung: Das Burgauer Wappen zeigt im grünen Schild einen gemauerten silbernen Brunnen mit Brunnenrad und Brunnenhaube.
Persönlichkeiten:
Ehrenbürger:
Hermann Wallner († 2019), Bürgermeister von Burgau 1990–2003
Söhne und Töchter der Gemeinde:
Aegidius Schenk (1719–1780), Komponist und Organist
Josef Siegl (1887–1923), Politiker der Christlichsozialen Partei, Abgeordneter zum Nationalrat 1920–1923
Reinhard Müller (* 1954), Soziologe
Quelle: Dieser Text basiert auf dem Artikel Burgau_(Steiermark) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons CC-BY-SA 4.0 (Text erweitert). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Bilder: www.nikles.net.
Geografie: Die Grenze im Osten bildet die Lafnitz, deren Tal rund 220 Meter über dem Meer liegt. Nach Westen steigt das Land zum Galgenwald und zum Entenwald auf 350 Meter an.
Die Gemeinde hat eine Fläche von 20,0 Quadratkilometer. Davon sind 38 Prozent landwirtschaftliche Nutzfläche und 53 Prozent sind bewaldet.
Gliederung: Es existieren außer Burgau keine weiteren Katastralgemeinden.
Nachbargemeinden:
Neudau,
Burgauberg-Neudauberg,
Bad Waltersdorf,
Deutsch Kaltenbrunn und
Bad Blumau.
Geschichte: Das ursprünglich mit einem breiten Wassergraben befestigte Schloss war eine strategisch wichtige Grenzfestung gegen die Bedrohungen aus dem Osten und erhielt zusätzlichen Schutz durch die beiden Flüsse Lafnitz und Loben. Bis in das 12. Jahrhundert gibt es keine Quellen, die auf die Herrschaft Burgau Bezug nehmen. Das ehemalige Wasserschloss „Burg in der Au“ wird erst 1367 unter der Herrschaft der Herren von Puchheim (Adelsgeschlecht), die Burgau als landesfürstliches Lehen besaßen, urkundlich erwähnt. Der später zu einem Türkeneinfall umgedichtete Ungarneinfall von 1418 zog auch Burgau in Mitleidenschaft.
1429 gingen Markt und Feste Burgau als landesfürstliches Lehen an das Geschlecht der Herren von Neitperg (Burg Neuberg). Hans von Neitperg war der letzte seines Namens und Stammes, nach dessen Tod das Lehen durch die Herren von Polheim übernommen wurde. Die Polheimer verwalteten ihre Güter von Seggauberg (bei Leibnitz) aus. In dieser Zeit wurde Burgau den Vernichtungszügen der Söldner des Andreas Baumkircher ausgesetzt, die nach der verlorenen Schlacht bei Fürstenfeld und der Hinrichtung ihres Anführers 1471 die Oststeiermark und damit auch Burgau bis 1475 devastierten. Mit der Unterstützung Weikhard von Polheims ging die Bevölkerung daran, den Ort und die Kirche, in der sich das Epitaph Weikhards befindet, wieder aufzubauen. Fünf Jahre nach dem Tod Weikhards im Jahre 1489 empfing sein Sohn Seifried für sich und seinen Bruder, die beide in Linz ansässig waren, von Friedrich III. die Herrschaft Burgau als Lehen. Trotz der Verhandlungen mit Ungarn, die sie vor weiteren Einfällen bewahrten, geriet Seifried von Polheim in große finanzielle Schwierigkeiten und musste aufgrund von Zahlungsunfähigkeit das Schloss im November 1498 um 200 Gulden verpfänden. Im Jahre 1500 bekam Erhard von Polheim wegen seiner Tapferkeit gegen die Türken die Herrschaft Burgau nun als freies Eigen geschenkt und ging sofort daran, die Befestigungsanlagen der Burg auszubauen. So konnten die Türken 1529 und 1532 erfolgreich abgewehrt werden. Allerdings wurden zahlreiche Burgauer von den Türken, die in diesem Jahr auch Wien zum ersten Mal belagerten, verschleppt und getötet.
Ab 1530 verwaltete Weikhart von Polheim für seinen Vater Erhard die Herrschaft, ab 1538 folgte er ihm im Besitz. Ebenfalls von Geldsorgen geplagt, veranlasste er den Umbau der Burg und ließ den Bergfried abtragen, die Wehrmauern verstärken, die nun die Vorburg mit dem Wohnschloss verbanden, an der Südfront der Vorburg zwei neue Wehrtürme errichten und einen Wassergraben anlegen. Das Torhaus wurde nun durch eine Zugbrücke verschlossen, eine Holzbrücke überspannte den Wehrgraben. Damals erhielt der Wehrbau sein endgültiges Aussehen. Das Schloss Burgau war somit zu einem großen Wasserschloss ausgebaut. Nach dem Tode Weikhards von Polheim 1550 verwaltete sein Bruder Hans das Schloss für seinen Sohn Wigolens.
1559 und 1564 musste die verschuldete Herrschaft Burgau verpfändet werden, die noch im darauffolgenden Jahr als Erbe an Hans von Zelking fiel, der sie an Mathias von Trauttmannsdorff verkaufte, dessen Familie durch hohe Abgaben des Robots (Frondienst) die Bevölkerung unter Druck setzte. Ein Gesuch der Bürger von Burgau um Robotbefreiung aus dem Jahre 1675 bzw. 1687 wurde von der innerösterreichischen Regierung abgewiesen. An diese Besitzperiode erinnert ein Inschriftstein, der mit dem Trauttmannsdorffschen Wappen über dem Eingangsportal folgende Worte trägt: „Maximilian Graf von Trautmannsdorf und Weinsberg, Ritter des goldenen Vlies, Röm. Kais. Majestät Ferdinand III. geheimer Rath, Kämmerer und Obersthofmeister“.
Im Jahre 1704 fielen die Kuruzen, rebellische Gegner der habsburgischen Herrschaftsansprüche, in dieses Gebiet ein und weite Teile der Oststeiermark wurden verwüstet. Dass Burgau wie durch ein Wunder von diesen Attacken zum Großteil verschont blieb, ist nur auf die geschickte Verhandlungstaktik des Burgauer Bürgermeisters zurückzuführen, der den Rebellen Waren und Münzen als Lösegeld angeboten hatte. Max Gundakher Graf von Trauttmannsdorff, der schon 1749 einen Teil des Besitzes von seinem Vater übernommen hatte, verkaufte 1753 diesen schließlich an den aus ungarischem Adel stammenden Grafen Adam III. Batthyány, dessen Familie zu den bedeutendsten Besitzern der Herrschaft Burgau zählt.
Dessen Sohn und Nachfolger, Karl II. Graf Batthyány (1742–1814) war kaiserlicher Botschafter in London. Er war von der rein maschinell arbeitenden neuen Spinntechnik in England überzeugt und hatte zwei Baumwollstreckmaschinen und eine Spinnmaschine aus England herausschmuggeln und nach Burgau transportieren lassen, wo er 1789 die erste Baumwollspinnerei der Habsburgermonarchie gründete und so wesentlich zur Schaffung von Arbeitsplätzen für die einheimische Bevölkerung beitrug. Später wurde für die Arbeiter der Spinnfabrik sogar eine eigene Arbeitersiedlung, der sogenannte „Untere Markt“, errichtet. Schwierigkeiten mit der Rohstoffbeschaffung, zunehmende Konkurrenz aus dem Wiener Raum und die Franzosenkriege führten 1808 zu einer zeitweiligen Schließung der Fabrik.
1831 erwarb der Wiener Garngroßhändler Georg Borckenstein (1787–1863) die Fabriksanlagen und erweiterte und modernisierte sie, sodass vier Jahre später die Produktion wieder aufgenommen werden konnte. 1843 erfolgte eine Expansion des Betriebs ins benachbarte Neudau: Eine Erweiterung in Burgau wurde vom Gemeinderat abgelehnt, weil die damit verbundenen Soziallasten damals von der Gemeinde zu tragen waren. Im Laufe des 20. Jahrhunderts wurde der Betrieb dann vollständig nach Neudau verlagert und 1987 wurden die alten Fabriksgebäude in Burgau geschleift und Wiesen angelegt. Die ab 1853 „G. Borckenstein und Sohn“ genannte Firma fusionierte 1979 mit ihrem Miteigentümer „Seutter & Co.“ Zuletzt (2019) hieß die Firma „Borckenstein GmbH“.
In Burgau befand sich nicht nur die älteste Textilfabrik der Donaumonarchie, auch andere technische Errungenschaften lassen sich hier schon früh nachweisen. So beschaffte Graf Carl Batthyány auch eine moderne Dreschmaschine aus England; bereits 1884 wurde Burgau durch die Lokalbahn Bierbaum–Neudau an das Eisenbahnnetz angeschlossen und im Jahre 1909 wurde hier durch den k.u.k. Hauptmann Johann Svetits ein Elektrizitätswerk erbaut.
Der letzte Besitzer von Schloss Burgau, Graf Lajos Batthyány, Nachfolger von Graf Carl Batthyány, wurde als Ministerpräsident und Anführer der Märzrevolution in Ungarn verhaftet und im Oktober 1849 hingerichtet. In Gedenken an ihn wurde im Oktober 1999 zum 150. Todestag eine Batthyány-Büste und Gedenktafel im Schlosshof angebracht.
Seit 1871 ist das Schloss im Besitz der Marktgemeinde Burgau. Bis 1968 war die Volksschule im Schloss untergebracht. 1990 richtete Ryke Geerd Hamer dort ein Zentrum für Neue Medizin ein, das 1995 behördlich geschlossen wurde.
In den letzten Jahren wurden das Schloss, der Innenhof und die Vorburg mit Rundturm restauriert. Der Rundturm beherbergt das Gemeindeamt und ein Schlosscafé, in der Vorburg (ehemaliger Bedienstetentrakt) befinden sich Wohnungen. Der Keller des Hauptschlosses zeigt ein schönes Ziegelgewölbe und wird für Veranstaltungen genutzt. Der Festsaal im zweiten Stock des Schlosses sowie der Innenhof mit den Arkadengewölben wird für kulturelle Veranstaltungen genutzt. (Ausstellungen, Konzerte, Theateraufführungen, Hochzeiten, Kongresse …)
1998 wurde der Wassergraben auf der Westseite des Schlosses wieder errichtet.
Kultur und Sehenswürdigkeiten:
Angerkreuz: Das Angerkreuz befindet sich am Angerweg in Burgau und wurde Mitte des 18. Jahrhunderts errichtet.
Bildeiche: Zur Erinnerung an einen Viehhändler, der sich mit viel Geld in den Taschen vor Räubern auf eine Eiche gerettet hat.
Brunnen am Hauptplatz: Bei der Erneuerung des Burgauer Ortsbildes wurde am Hauptplatz ein Steinbrunnen errichtet.
Brunnen am Johannesplatz: Der Brunnen befindet sich am Johannesplatz in Burgau.
Denkmal Gottfried Schlegl: Das Denkmal Gottfried Schlegl befindet sich beim Kirchenplatz in Burgau. Die Inschrift lautet: "Errichtet von Berg- und Naturwächter Gottfried Schlegl zum Dank.".
Dreifaltigkeitskapelle: Die Dreifaltigkeitskapelle befindet sich in unmittelbarer Nähe der Pfarrkirche Mariä Geburt und ist unter der Objekt-ID: 725 (HERIS-ID: 4867) denkmalgeschützt.
Ehem. Fabrikantenvilla Borckenstein: Die ehem. Fabrikantenvilla Borckenstein befindet sich an der Parkstraße 70 in Burgau und ist seit 2021 unter der HERIS-ID: 4873 denkmalgeschützt.
Feldkreuz: Für die Bittprozessionen vor Christi Himmelfahrt.
Frühmann-Denkmal: Ein steinernes Denkmal, das an den beim Holzschlagen verunglückten Herrn Julius Frühmann (Wehrführer und Bez. Wehrführer Stellvertreter, † 16.10.1935, Freiw. Feuerwehr und Rettungs-Abteilung Burgau) aus Burgau erinnert.
Galgenkreuz: Bei dem sogenannten Galgenkreuz handelt es sich um einen gemauerten Bildstock mit einer Steinpietà aus dem 16. / 17. Jahrhundert. Sockel mit Engelskopf. Pieta, vor der die zum Tode Verurteilten ihr letztes Gebet verrichteten. Der Galgen war ein dreibeiniges, hölzernes Gestell und stand im sogenannten Galgenwald. Die letzte Hinrichtung erfolgte zu Zeiten Maria-Theresias. Maria Rath wurde zum Tode verurteilt, weil sie ihr Kind tötete. Der Bildstock ist unter der Objekt-ID: 713 (HERIS-ID: 4855) denkmalgeschützt.
Gedenktafel für Lajos Batthyány: Die Gedenktafel für Lajos Batthyány (Inschrift in Ungarisch und Deutsch) befindet sich im Innenhof des Wasserschlosses.
Grabdenkmal Kaler von Lonzenheim: Das Grabdenkmal Kaler von Lonzenheim befindet sich am Friedhof und ist unter Objekt-ID: 724 (HERIS-ID: 4866) denkmalgeschützt.
Grabenackerkreuz: Dieses Feldkreuz wurde im Oktober 2010 durch den ÖAAB-Burgau errichtet und durch Pfarrer Josef Karl Fleck eingeweiht. Das ursprüngliche Kreuz, welches weiter südlicher stand, war nicht mehr instandsetzbar. 1949 wurde das alte Kreuz letztmalig hergerichtet und bei der 1. Bittprozession am 23.5.1949 durch Pfarrer Anton Fink geweiht. Christusschnitzer: Martin Bauer aus Kemeten, Kreuzerbauer: Johannes Wagner aus Burgau.
Grundzusammenlegung bzw. Flurbereinigung: Denkmal zur Grundzusammenlegung Nord 1992-1997 in Burgau. Josef Lederer aus Burgau.
Hl. Johannes Nepomuk: Die Figur des Hl. Johannes Nepomuk befindet sich beim Haus Skulpturen Eder am Johannesplatz 92, direkt bei der Brücke über den Lobenbach.
Kapelle: Die Kapelle befindet sich an der Grenze zwischen Burgau und Neudau.
Köberlpark: Der Köberlpark befindet sich gegenüber dem Wasserschloss in Burgau, direkt neben dem Freibad bzw. dem Schlossbad Burgau. Die Anlage dient als Erholungsort und beinhaltet auch einen Kinderspielplatz.
Kreuz: Das Kreuz aus Holz befindet sich an der Grenze zwischen der Steiermark und dem Burgenland, an der Lafnitz, beim Gasthaus Loatawagerl.
Kriegerdenkmal: Das Soldatendenkmal befindet sich an der Außenwand der Pfarrkirche Maria Gnadenbaum in Burgau in der Steiermark. Es ist geschützt durch ein vorspringendes Dach mit einem Sgrafitti mit Kriegsszenen, darunter befinden sich die Wandplakette mit den Namen der Gefallen und Vermissten aus dem 1. und 2. Weltkrieg.
Lamminger-Marterl: Das Marterl ist einer Frau Lamminger (1901-1921) gewidmet.
Leidensmann-Kapelle: Die Leidensmann-Kapelle befindet sich bei der Fürstenfelder Straße 84 in Burgau und ist unter der Objekt-ID: 729 (HERIS-ID: 4871) denkmalgeschützt. Die Mitte des 18. Jahrhunderts errichtete Leidensmann-Kapelle zeigt Stuckzierat an den Lisenen und hölzerne Skulpturen "Christus an der Geiselsäule" und "Christus in der Wies". Renoviert 1983 und 2009 von der steirischen Frauenbewegung Burgau.
Luther-Kreuz: Zur Erinnerung an den verunglückten Förster Luther, den sein Hund einige Tage bewacht und dann den Suchtrupp zu ihm geführt hat.
Mariazeller Kreuz: Ein Holzkreuz, bei dem die Fußwallfahrer bei der Wanderung nach Mariazell jedes Jahr ihr erstes Gebet verrichten († 1983 †).
Mariazellerplatzl, Fußwallfahrer: Dieser Platz vor der Pfarrkirche Mariä Geburt in Burgau ist ein sichtbares Zeichen der Burgauer Fußwallfahrer und soll einladen zu rasten, Gespräche miteinander und Gespäche mit Gott zu führen. Die Skulptur in der Mitte wurde 2008 von Josef Lederer aus Burgau geschaffen.
Mariensäule am Hauptplatz: Am Burgauer Hauptplatz 9 befindet sich auf einem quadratischen Sockel eine ca. elf Meter hohe Mariensäule. Sie wurde 1750 errichtet und an der Spitze befindet sich eine vergoldete Marienfigur aus der Veit Königer Werkstatt, die nach Osten blickt; zur Erinnerung, aus welcher Richtung die Pest in den Ort kam. Ein Stich des Topographen Georg Matthäus Vischer vom Markt Burgau lässt allerdings vermuten, dass sich eine Säule bereits um 1670 auf dem Hauptplatz befunden hat. Auf der Marmortafel am Fuß der Säule ist auch das Jahr 1778 vermerkt, in dem ein heftiges Unwetter den Ort verwüstete. Bei diesem Unwetter wurde u. a. die Mariensäule umgeworfen und auch der nördliche Turm des Schlosses zerstört. Seit diesem Unwetter ist der Heilige Donatus der Ortspatron von Burgau und ihm zu Ehren wird jedes Jahr am zweiten Sonntag im Juli eine Bittprozession mit anschließendem Pfarrfest abgehalten (Objekt-ID: 708, HERIS-ID: 4850).
Mühlhauser Kapelle: Die Mühlhauser Kapelle befindet sich bei der Fürstenfelder Straße 84 in Burgau und ist unter der Objekt-ID: 729 (HERIS-ID: 4871) denkmalgeschützt. Die Mühlhauser-Kapelle zeigt Stuckzierat an den Lisenen und ein hölzernes Gnadenbild Christus in der Wies, beides aus der Mitte des 18. Jahrhunderts.
Müllnerkreuz: Das Müllnerkreuz befindet sich an der Kreuzung Forsthausweg und Sonnenblumenweg in Burgau.
Ofner-Bildstock: Bildstock der Familie Ofner, zum Dank für die Rückkehr von Peter Ofner aus russischer Gefangenschaft errichtet.
Pfarrkirche Mariä Gnadenbrunn: Die römisch-katholische Pfarrkirche Mariä Geburt steht auf einer Bodenschwelle in freier Lage im Westen des Dorfes in der Gemeinde Burgau im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld in der Steiermark. Die dem Patrozinium Mariä Geburt unterstellte Pfarrkirche gehört zur Region Oststeiermark (Dekanat Waltersdorf) in der Diözese Graz-Seckau. In der Pfarrkirche Burgau findet jedes Jahr von April bis Oktober an jedem 13. Tag des Monats eine Wallfahrt statt. Die Pfarrkirche Mariä Geburt ist unter der Objekt-ID: 732 (HERIS-ID: 4874) denkmalgeschützt.
Pieberkreuz: Das Mitte des 18. Jahrhunderts errichtete Pieberkreuz befindet sich beim Alt-Bürgermeister Weg (Kreuzung Hochstraße und Vorderauweg) in Burgau.
Rotes Kreuz: Das Rote Kreuz befindet sich an der Burgauerstraße (L402), gegenüber dem Spar bzw. Gebrauchtwagen Florian. Es wurde 2002 von der Frauenbewegung Burgau renoviert und erneuert. Die Renovierung des Herrgottes erfolgte im Jahr 2007.
Schwarzes Kreuz: Das Schwarze Kreuz, im Volksmund auch "Pestkreuz" genannt, in Burgau ist ein Bildstock zur Erinnerung an die Pest in Burgau. Tabernakelbildstock Sandsteinfigur "Madonna mit Kind" (gew. d' Altsteirer z' Burgau).
Steinbrunnen: Bei der Erneuerung des Burgauer Ortsbildes wurde am Hauptplatz auch ein Steinbrunnen neu angelegt und um die alte Linde (Naturschutzdenkmal) eine Rundbank aufgestellt.
Schlossbad: Das Strandbad mit einem Naturteich befindet sich direkt neben dem Wasserschloss in Burgau.
Tabaktrockenanlage: Die Tabaktrockenanlage befindet sich gegenüber dem Lobenweg 342 in Burgau und ist unter der Objekt-ID: 722 (HERIS-ID: 4864) denkmalgeschützt.
Tschartake: Anlässlich der Ausstellung Labonca-Lafnitz - Leben an einer der ältesten Grenzen Europas im Jahr 1995, wurde direkt an der Lafnitz ein Grenzwächterhaus, die Tschartake, nachgebaut. Dieses Grenzwächterhaus liegt am sogenannten „Kuruzzenwanderweg". Dieser Wanderweg ist auch gleichzeitig ein Naturlehrpfad, der Schautafeln über die Flora und Fauna im Hügelland, die Bedeutung der Hecken, die Ökologie der Aulandschaft, die Bedeutung der Streuobstwiesen und über die Veränderungen der Landschaft durch Anbau zeigt. Im August 2012 wurden die Tschartake sowie die Brücke über die Lafnitz im Zuge der notwendigen Renovierung komplett erneuert.
Wasserschloss Burgau: Die Burg (Wasserschloss) wurde vermutlich zu Beginn des 14. Jahrhunderts errichtet und bestand ursprünglich nur aus einem von Wassergräben umgebenen Wehrturm. Erhard von Polheim errichtete 1538 die große zweigeschossige Vorburg. Das heutige Aussehen erhielt die Hauptburg 1624 durch einen großzügigen Ausbau. Bei einem Unwetter 1778 wurde der Mittelturm des Schlosses stark beschädigt und daraufhin abgetragen. Seit 1870 ist die Marktgemeinde die Eigentümerin der Burg. Sie nutzt das Gebäude als Gemeindeamt und für Veranstaltungen, in der Vorburg wurden Wohnungen geschaffen. Außerdem erhielt der Innenhof des Schlosses im September 1999 den 4. Tisch einer 5-teiligen Steintischserie, den sogenannten Utopientisch (Objekt-ID: 705, HERIS-ID: 4847).
Ziegelteich-Kreuz: Das hölzerne Kreuz befindet sich beim Ziegelteich.
Arbeitsmarkt, Pendeln: Im Jahr 2011 lebten 431 Erwerbstätige in Burgau. Davon arbeiteten 122 in der Gemeinde, mehr als 70 Prozent pendelten aus.
Städtepartnerschaft: Bereits seit Mitte der 1970er Jahre bestehen Kontakte zur Markgrafenstadt Burgau in Bayern. Offiziell besiegelt wurde die Partnerschaft im Jahr 1982.
Wappen: Blasonierung: Das Burgauer Wappen zeigt im grünen Schild einen gemauerten silbernen Brunnen mit Brunnenrad und Brunnenhaube.
Persönlichkeiten:
Ehrenbürger:
Hermann Wallner († 2019), Bürgermeister von Burgau 1990–2003
Söhne und Töchter der Gemeinde:
Aegidius Schenk (1719–1780), Komponist und Organist
Josef Siegl (1887–1923), Politiker der Christlichsozialen Partei, Abgeordneter zum Nationalrat 1920–1923
Reinhard Müller (* 1954), Soziologe
Quelle: Dieser Text basiert auf dem Artikel Burgau_(Steiermark) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons CC-BY-SA 4.0 (Text erweitert). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Bilder: www.nikles.net.
Disclaimer
Danke, dass Sie unsere Webseite ausgewählt haben. Wir freuen uns, Sie hier zu haben und möchten unser Wissen mit Ihnen teilen. Sie können uns gerne zu verschiedenen Themen unter der Email office@nikles.net schreiben. Wir antworten in der Regel innerhalb eines Tages.
Die meisten Bilddateien sind aus eigener Quelle und können auf Anfrage kostenlos für eigene Webseiten verwendet werden. Auf Wunsch auch in höherer Auflösung.
Kontakt
Bevorzugte Kontaktaufnahme ist Email.
Email:
office@nikles.net
Website:
www.nikles.net
Günter Nikles,
Josef Reichl-Straße 17a/7,
A-7540 Güssing
Österreich