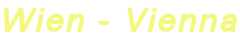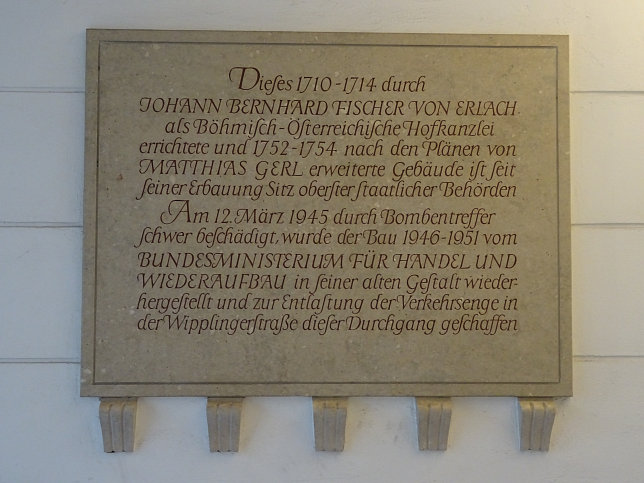01. Bezirk - Böhmische Hofkanzlei
Mit Böhmischer Hofkanzlei wird zum einen eine Behörde bezeichnet, welche von 1527 bis 1749 bestand, zum anderen ihr ehemaliger Amtssitz am Judenplatz in der Wiener Innenstadt, der heute den österreichischen Verfassungsgerichtshof und den österreichischen Verwaltungsgerichtshof beherbergt.
Die Behörde: Da die böhmischen Stände eine von der
österreichischen Kanzlei abgesonderte Einrichtung gewünscht
hatten, wurde 1527 die Böhmische Hofkanzlei von Ferdinand I.
errichtet, der im selben Jahr zum böhmischen König gekrönt
worden war. Sitz dieser Hofkanzlei war zuerst der Hradschin
in Prag. Berühmtheit erlangten diese Räumlichkeiten
insbesondere durch den Zweiten Prager Fenstersturz, der hier
1618 stattfand.
Nach Niederschlagung des Böhmischen Aufstandes in der
Schlacht am Weißen Berg 1620 wurde die Hofkanzlei nach Wien
verlegt und allein dem böhmischen König unterstellt. Ihr
Aufgabengebiet wurde beträchtlich erweitert, in der
Hofkanzleiordnung von 1719 wurde sie sowohl als „unser
königliches und landesfürstliches allerhöchstes Gericht“ als
auch als „unsere letzte und höchste königliche Stelle“
bezeichnet. Die Hofkanzlei vereinigte alle Verwaltungs- und
Justizaufgaben in ihrer Hand.
Als Ausdruck des böhmischen Partikularismus innerhalb der
Habsburgermonarchie war die Böhmische Hofkanzlei bzw. ihr
letzter Oberstkanzler Friedrich Graf Harrach ein erbitterter
Feind der Zentralisierungsbestrebungen, die von Maria
Theresias Berater Friedrich Wilhelm Graf Haugwitz ausgingen.
Letztlich aber konnte Haugwitz obsiegen, und 1749 wurde die
Böhmische Hofkanzlei aufgelöst, ihre Aufgaben sowie jene der
zugleich aufgelösten Österreichischen Hofkanzlei wurden zwei
neuen Behörden übertragen: dem Directorium in publicis et
cameralibus sowie der Obersten Justizstelle.
Das Palais: Das Palais der Böhmischen Hofkanzlei
wurde 1709-1714 nach Plänen von Johann Bernhard Fischer von
Erlach auf der Wipplingerstrasse errichtet. Es war der erste
Bauauftrag für Fischer in Wien nach einer fast zehnjährigen
Pause. Sein letztes Palais war das Palais Batthyány in der
Renngasse gewesen, welches in spätbarockem Stil gehalten
war. Mit der Böhmischen Hofkanzlei machte Fischer eine
Kehrtwendung zurück zum Hochbarock bzw. zur antiken
Formensprache, wobei auch sein langjähriger
Italien-Aufenthalt wichtige Impulse gegeben hat,
möglicherweise auch eine 1704 nicht sicher stattgefundene
Englandreise. So lässt insbesondere die vertikale Gliederung
des Palais in drei Teile zu je drei Achsen ein
palladianisches Schema erkennen. Doch wurde die kühle
palladianische Gliederung durch reichen plastischen Schmuck
mehr als aufgewogen. Insbesondere der Mittelteil, der zu
einem Risalit mit Giebel ausgestaltet war, ließ auch
mehrfach die ursprüngliche Zweckwidmung des Palais erkennen:
durch einen Löwen (als dem böhmischen Wappentier), der auf
dem Giebel thront, durch einen Löwenkopf, der das
Eingangstor bewacht, sowie durch die Wappen der böhmischen
Länder über dem Piano Nobile. Steinmetzaufträge erhielten
die Meister Giovanni Battista Passerini und Hans Georg
Haresleben aus Kaisersteinbruch, harter Kaiserstein wurde
insbesondere für die Löwen-Stiege verwendet.
Nach der Staatsreform von 1749 bezogen die neuen, auch für
die österreichischen Länder zuständigen Behörden, Quartier
im Fischer'schen Palais, das sich rasch als viel zu klein
herausstellte. So wurden die restlichen Parzellen des
Häuserblocks parallel zum Judenplatz hin aufgekauft und
Matthias Gerl mit der Erweiterung des Palais beauftragt. In
den Jahren 1751-1754 verdoppelte Gerl das Palais nach Westen
hin symmetrisch, sodass das Palais in seiner ursprünglichen
Hauptfront zur Wipplingerstraße nunmehr zwanzig Achsen mit
zwei giebelbekrönten Risaliten aufweist. Besonderes
Augenmerk schenkte Gerl aber auch der Rückfront, die nunmehr
in den Judenplatz hineinragte und so einen weit besseren
Blick bot als die Hauptfront. Sie wurde mit 22 Achsen und
insgesamt drei Risaliten ausgeschmückt, wovon nur die beiden
äußeren giebelbekrönt waren. Steinmetzmeister Johann Michael
Strickner aus Kaisersteinbruch lieferte die Stiegenstaffel
für die Putten-Stiege.
Weitere Umbauten erfolgten im 19. Jahrhundert, u.a. wurde
das Innere 1895/96 durch Emil von Förster neu gestaltet und
erhielt damals im Wesentlichen sein heutiges Aussehen. 1945
wurde das Palais durch eine Fliegerbombe schwer beschädigt.
Die Wiederaufbauarbeiten unter Erich Boltenstern wurden zu
weiteren Adaptierungen benutzt, u.a. wurde damals die
Fußgängerpassage in der Wipplingerstraße eingerichtet. Die
Eingangstore zur Wipplingerstraße wurden damit funktionslos,
heute betritt man das Palais über die Tore zum Judenplatz
bzw. zur Jordangasse.
Quelle: Dieser Text basiert auf dem Artikel Böhmische_Hofkanzlei aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons CC-BY-SA 4.0 (Text erweitert). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.
Bilder: www.nikles.net.
Willkommen
Danke, dass Sie unsere Webseite ausgewählt haben.
Wir freuen uns, Sie hier zu haben und möchten unser Wissen mit Ihnen teilen.
Sie können uns gerne zu verschiedenen Themen unter der Email office@nikles.net schreiben.
Wir antworten in der Regel innerhalb eines Tages.
Die meisten Bilddateien sind aus eigener Quelle und können auf Anfrage kostenlos für eigene Webseiten verwendet werden.
Auf Wunsch auch in höherer Auflösung.
Kontakt
Günter Nikles
Josef Reichl-Str. 17a/7
7540 Güssing
Austria
Email:
office@nikles.net
Website:
www.nikles.net
(c) 2025 www.nikles.net