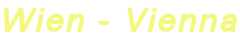03. Bezirk - Konzerthaus
Das Wiener Konzerthaus wurde 1913 eröffnet. Es liegt im 3. Wiener Gemeindebezirk Landstraße am Rand der Inneren Stadt zwischen Schwarzenbergplatz und Stadtpark.
Baugeschichte: Ein 1890 geplantes Haus für
Musikfeste sollte als Mehrzweckbau breitere
Bevölkerungsschichten ansprechen als der nur 200 Meter
entfernte traditionsreiche Wiener Musikverein. Der Entwurf
des Architekten Ludwig Baumann für ein Olympion enthielt
außer mehreren Konzertsälen einen Eisplatz und einen
Bicycleclub. Daneben sollte eine Freiluft-Arena 40.000
Besuchern Platz bieten. Zwar wurde der Plan abgelehnt, aber
fast 20 Jahre später mit einer kleineren Sportarena
verwirklicht, in der der Wiener Eislaufverein bis heute
beheimatet ist. Auch das beliebte Freistilringen Am Heumarkt
findet hier statt.
Das Wiener Konzerthaus wurde schließlich von 1911 bis 1913
von den europaweit tätigen Wiener Theaterarchitekten
Ferdinand Fellner d. J. und Hermann Helmer (Büro Fellner &
Helmer) in Zusammenarbeit mit Ludwig Baumann errichtet.
Das Motto des Konzerthauses lautete:
Eine Stätte für die Pflege edler Musik, ein Sammelpunkt
künstlerischer Bestrebungen, ein Haus für die Musik und ein
Haus für Wien.
Am 19. Oktober 1913 wurde das Konzerthaus in Anwesenheit von
Kaiser Franz Joseph I. mit einem Festkonzert eröffnet.
Richard Strauss komponierte hierfür sein Festliches
Präludium op. 61. Kombiniert wurde dieses moderne Werk mit
Beethovens 9. Sinfonie - das Nebeneinander von Tradition und
Moderne sollte so schon im ersten Konzert des Hauses
deutlich werden.
Der Zerfall Österreich-Ungarns brachte enorme
gesellschaftliche Umbrüche und finanzielle Krisen - und so
wurde Flexibilität und Vielseitigkeit auch aus Geldmangel
notwendig. Neben klassischem Repertoire gab es in den 1920er
und 1930er Jahren wichtige Uraufführungen (u. a. von Arnold
Schönberg und Erich Wolfgang Korngold), Konzerte mit Jazz
und Schlagern, Vorträge von Wissenschaft bis Spiritismus und
Dichterlesungen (u. a. von Karl Kraus). Tanz- und
Ballveranstaltungen, einige große Kongresse und
Weltmeisterschaften für Boxen und Fechten rundeten das
Programm ab.
Nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich 1938
verarmte das Programm zum „nicht-entarteten
Unterhaltungsbetrieb“; vielen Künstlern blieb nur die
Emigration.
Nach 1945 hatte das Konzerthaus auch die Nebenaufgabe, das
geknickte österreichische Selbstbewusstsein auf musikalische
Weise „aufzupäppeln“. Neben dem Standardrepertoire der
Klassik und Romantik und dem Wiener Walzer gab es weiterhin
Uraufführungen (z. B. Schönbergs Oratorium Die Jakobsleiter
1961) sowie internationalen Jazz und Popkonzerte.
Nach mehreren Umbauten, die die originale
Jugendstildekoration geringfügig veränderten, wurde das Haus
von 1972 bis 1975 nach nur leicht veränderten Originalplänen
wiederhergestellt. Von 1998 bis 2001 wurde das Haus unter
Architekt Hans Puchhammer generalsaniert und um einen neuen
Konzertsaal (Neuer Saal) erweitert.
Von 1989 bis 2002 fand im Konzerthaus außerdem der Wiener
Kathreintanz statt.
Gebäude: Das im Grundriss etwa 70 mal 40 Meter
große Konzerthaus umfasst seit der Eröffnung drei
Konzertsäle:
* Großer Saal mit 1865 Plätzen
* Mozart-Saal mit 704 Plätzen
* Schubert-Saal mit 366 Plätzen
* Der Neue Saal (mit ca. 400 Plätzen) wurde erst im Zuge der
Generalsanierung von 1998 bis 2002 errichtet.
An der Hausfront, zur Rechten und Linken des Einganges,
befindet sich die Inschrift:
Ehrt eure deutschen Meister, dann bannt ihr gute Geister.
Dabei handelt es sich um ein Zitat aus dem Schlusschor zur
Oper Die Meistersinger von Nürnberg von Richard Wagner.
In allen Sälen können gleichzeitig unterschiedliche Konzerte
stattfinden, da sie sich akustisch gegenseitig nicht
beeinflussen.
Im Inneren steht im Foyer das Originalmodell des 1878 von
Kaspar von Zumbusch geschaffenen Beethoven-Denkmals, das
gegenüber dem Konzerthaus am
Beethovenplatz
aufgestellt ist. Beim Treppenaufgang befindet sich ein
Relief Huldigung an Kaiser Franz Joseph (1913) von Edmund
Hellmer. Weiters ist eine Büste Franz Liszts von Max Klinger
um 1904 zu erwähnen.
Zum Komplex des Konzerthauses gehört auch das Gebäude der K.
k. Akademie für Musik und darstellende Kunst (heute
Universität für Musik und darstellende Kunst). Neben Räumen
für den universitären Lehrbetrieb enthält dieser Gebäudeteil
auch das Akademietheater mit 521 Plätzen, das als Nebenbühne
des Burgtheaters unter anderem für Uraufführungen moderner
Schauspiele genutzt wird.
In der Nähe befindet sich das Josef-Labor-Denkmal (Lothringer Straße 20).
Quelle: Dieser Text basiert auf dem Artikel Wiener_Konzerthaus aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons CC-BY-SA 4.0 (Text erweitert). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.
Bilder: Clemens Pfeiffer unter der Lizenz CC BY-SA 2.0 at, Gryffindor unter der Lizenz CC BY-SA 2.5 und Buchhändler unter der Lizenz CC BY-SA 3.0.
Willkommen
Danke, dass Sie unsere Webseite ausgewählt haben.
Wir freuen uns, Sie hier zu haben und möchten unser Wissen mit Ihnen teilen.
Sie können uns gerne zu verschiedenen Themen unter der Email office@nikles.net schreiben.
Wir antworten in der Regel innerhalb eines Tages.
Die meisten Bilddateien sind aus eigener Quelle und können auf Anfrage kostenlos für eigene Webseiten verwendet werden.
Auf Wunsch auch in höherer Auflösung.
Kontakt
Günter Nikles
Josef Reichl-Str. 17a/7
7540 Güssing
Austria
Email:
office@nikles.net
Website:
www.nikles.net
(c) 2025 www.nikles.net