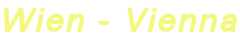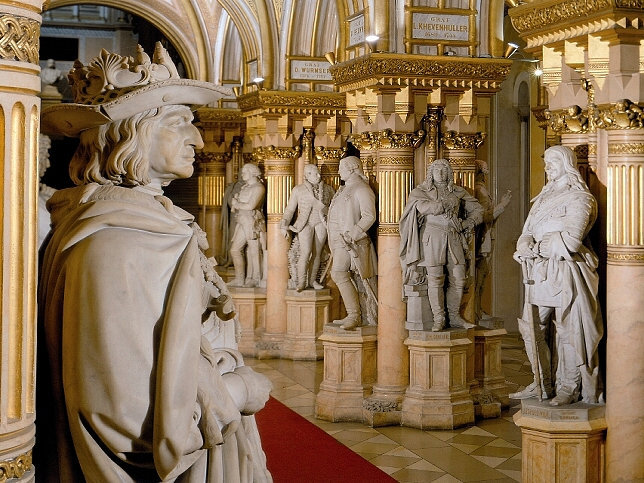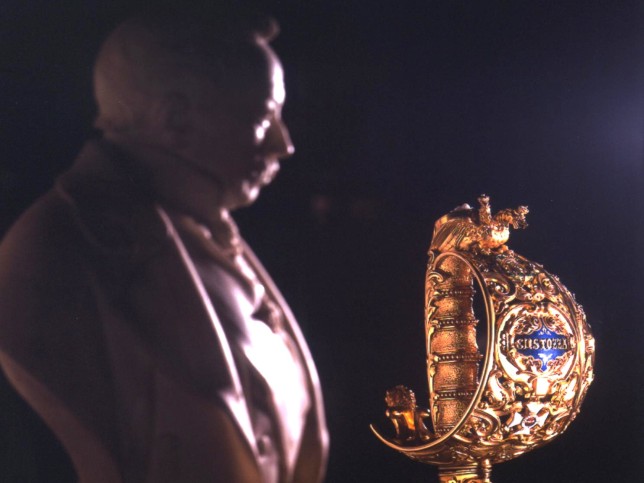03. Bezirk - Heeresgeschichtliches Museum
Das Heeresgeschichtliche Museum / Militärhistorische Institut befindet sich im Arsenal im 3. Wiener Gemeindebezirk Landstraße und ist das Leitmuseum des Österreichischen Bundesheeres und dokumentiert anhand von Exponaten die Geschichte des österreichischen Militärwesens, insbesondere Waffen, Rüstungen, Panzer, Flugzeuge, Uniformen, Fahnen, Gemälde, Orden und Ehrenzeichen, Fotografien, Schlachtschiffmodelle und Dokumente. Das Museum befindet sich im Bundesbesitz, ist jedoch nicht den Bundesmuseen angegliedert, sondern untersteht dem Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport.
Das Museumsgebäude und seine Geschichte: Der Museumsbau (Objekt 18) bildet das Herzstück des Wiener Arsenals, einem aus vormals insgesamt 72 Objekten bestehenden riesigen militärischen Gebäudekomplex, der aus Anlass der Revolution 1848/49 errichtet wurde. Es war das größte Bauvorhaben der ersten Regierungsjahre des jungen Kaisers Franz Joseph und diente nicht zuletzt auch der Festigung seiner neoabsolutistisch ausgerichteten Machtposition. Das Projekt des seinerzeitigen „Waffenmuseums“ wurde vom dänischen Architekten Theophil von Hansen ausgeführt. Bereits sechs Jahre nach Baubeginn (15. April 1850) erfolgte die Schlusssteinlegung am 8. Mai 1856. Das Gebäude ist somit der älteste - als solcher geplante und ausgeführte - Museumsbau Österreichs.
Fassade: Hansens Plan sah ein 235 Meter langes Gebäude mit vorspringenden Quertrakten und Ecktürmen sowie einen turmartigen Mittelteil von quadratischem Grundriss vor, von einer Kuppel bis in die Höhe von 43 Metern bekrönt. So wie viele Bauten des Historismus meist Vorbilder aus der Architekturgeschichte haben, zog auch Theophil von Hansen jenes des ab dem Jahr 1104 errichteten Arsenal in Venedig heran. Er übernahm byzantinische Stilelemente und setzte noch gotisierende Bauelemente hinzu. Besonders hervorzuheben ist die charakteristische Backsteinbauweise. Das aus zweifarbigen Ziegeln bestehende Mauerwerk ist mit Terrakottaornamenten und schmiedeeisernen Schließen geschmückt, die Gliederungen sind durch Hausteine hervorgehoben, der Mittelrisalit zeichnet sich durch ein reiches Fassadendekor, wie etwa den drei großen Rundfenstern vor den Seitenflügeln aus. Die reich geschmückte Attikazone wird von einem mächtigen Bogenfries getragen, der an florentinische Palastbauten erinnert. Der Schwalbenschwanzzinnenkranz wird an den Achsen der Seitenflügeln und an den Ecken des Mittelbaus durch kleine Türmchen unterbrochen, in deren Nischen Trophäenplastiken aus Terrakotta angebracht sind. An und vor der Fassade wurden von einem der bedeutendsten Bildhauer seiner Zeit, Hanns Gasser, aus Sandstein allegorische Figurendarstellungen der militärischen Tugenden ausgeführt. Unter den Rundfenstern sind dies die weiblichen Figuren (v. l. n. r.) der Stärke, Wachsamkeit, Frömmigkeit und Weisheit; neben den drei zur Vorhalle führenden Öffnungen sind, in männlichen Figuren, die Tapferkeit, Fahnentreue, Aufopferung und die kriegerische Intelligenz dargestellt.
Innenraum: Im Inneren des Heeresgeschichtlichen
Museums manifestiert sich die Absicht Kaiser Franz Josephs,
nicht bloß ein Gebäude für die kaiserlichen Waffensammlungen
zu errichten, sondern auch und vor allem eine Ruhmes- und
Gedenkstätte für die kaiserliche Armee auf großartige Weise
zu schaffen. So sind bereits in der Feldherrenhalle 56
ganzfigurige Porträtstatuen der „berühmtesten,
immerwährenden Nacheiferung würdiger Kriegsfürsten und
Feldherren Österreichs“, wie es in der kaiserlichen
Entschließung vom 28. Februar 1863 heißt, aufgestellt. Die
Statuen sind in Carraramarmor ausgeführt und mit 186 cm alle
einheitlich hoch. Namen und Lebensdaten der Dargestellten
sind oberhalb der Figuren auf Tafeln angebracht, auf den
Sockeln sind die 32 verschiedenen Namen der ausführenden
Künstler, der Zeitpunkt der Aufstellung und jener Mäzen
genannt, welcher die Kosten für die jeweilige Skulptur
übernahm. Die Kosten für die Hälfte trug Kaiser Franz Joseph
selbst, der Rest wurde von privaten Gönnern gestiftet,
oftmals handelte es sich dabei um Nachkommen des jeweils
porträtierten Feldherren. Der chronologische Bogen der
Feldherren spannt sich vom Babenberger Markgrafen Leopold I.
bis hin zum Habsburger Erzherzog Karl.
Auch das Stiegenhaus ist in prächtiger Weise ausgestattet.
Im Halbstock sind, nicht zuletzt um auf die runde Zahl von
60 Skulpturen zu kommen, weitere 4 Standbilder von
Feldherren aufgestellt, im Gegensatz zu den Figuren in der
eigentlichen Feldherrenhalle sind diese allerdings in
Wandnischen stark überhöht angebracht. Es handelt sich
hierbei um Akteure des Revolutionsjahres 1848, jene
militärischen Führer, die im Auftrag des Hauses Habsburg die
revolutionären Bestrebungen in allen Teilen der Monarchie -
zum Teil sehr blutig - niederschlugen, nämlich Julius von
Haynau, Josef Wenzel Radetzky, Alfred I. zu Windisch-Graetz
und Joseph Jelačić von Bužim. Die bildliche Ausgestaltung
des Stiegenhauses wurde Carl Rahl übertragen, der sie
gemeinsam mit seinen Schülern Christian Griepenkerl und
Eduard Bitterlich im Jahre 1864 ausführte. Im Zentrum der
reich mit Gold ornamentierten Decke befinden sich Fresken
mit allegorischen Darstellungen von Macht und Einigkeit
(Mitte), Ruhm und Ehre (rechts) und Klugheit und Mut
(links). Bekrönt wird das Stiegenhaus durch die allegorische
Marmorskulpturengruppe „Austria“ von Johannes Benk, die
dieser 1869 ausführte.
Den repräsentativsten Raum des Museums bildet sicherlich die
in der ersten Etage befindliche Ruhmeshalle. Besonders
beeindrucken die Fresken von Karl von Blaas, welche die
wichtigsten militärischen Ereignisse (Siege) aus der
Geschichte Österreichs seit den Babenbergern zeigen. In den
vier großen Wandbögen sind die Siege der kaiserlichen Armee,
die Schlacht bei Nördlingen 1634, der Kriegsrat in der
Schlacht bei St. Gotthard 1664, die Schlacht bei Zenta 1697
und der Entsatz von Turin 1706 dargestellt; im linken
Nebensaal die Ereignisse aus der Regierungszeit Maria
Theresias und Josephs II. bis zur Einnahme Belgrads 1789; im
rechten Nebensaal die Napoleonischen Kriege von der Schlacht
bei Würzburg 1796 über den Tiroler Freiheitskampf von 1809
bis zu den Waffenstillstandsverhandlungen des Feldmarschall
Radetzky mit König Vittorio Emanuele II. von Sardinien nach
der Schlacht bei Novara 1849. Die eigentliche Bedeutung der
Ruhmeshalle, nämlich die einer Gedenkstätte, ist eigentlich
erst auf den zweiten Blick ersichtlich: An den Wänden der
Nebensäle und auch in der Ruhmeshalle selbst sind mehrere
Marmortafeln angebracht, auf denen die Namen von über 500
Offizieren (von Oberst bis General der kaiserlichen Armee
vom Beginn des Dreißigjährigen Krieges1618 bis zum Ende des
Ersten Weltkrieges 1918 mit Ort und Jahr ihres Todes
vermerkt.
Geschichte: Das Museumsgebäude selbst wurde zwar
bereits 1856 fertig gestellt, jedoch dauerte die innere
Ausgestaltung bis zum Jahr 1872. Die Sammlung ergänzte sich
auch der ehemaligen Hof-Waffensammlung des kaiserlichen
Zeughauses, der kaiserlichen Privatsammlung im Schloss
Laxenburg sowie der Wiener Schatzkammer. Die Sammlung war
zunächst eine reine Waffen- und Trophäensammlung, deren
Schwerpunkt die Harnische und Waffen der kaiserlichen
Leibrüstkammer darstellten. Nach ihrer Ordnung wurde sie im
Jahre 1869 als „k.k. Hofwaffenmuseum“ erstmalig dem
öffentlichen Besuch freigegeben. Mit der Fertigstellung des
Gebäudes des Kunsthistorischen Museums wurden 1888 die
Bestände der kaiserlichen Sammlungen aus dem Arsenal zu
ihrem neuen Standort auf der Ringstraße überführt.
1885 wurde schließlich ein Kuratorium unter dem Vorsitz des
Kronprinzen Rudolf gebildet, dem die Bildung und
Ausgestaltung des fortan so genannten „k.k. Heeresmuseums“
oblag. Schwerpunkt der nunmehrigen Sammlung bzw. Ausstellung
sollten die Taten der kaiserlichen Armee sein. Der Kronprinz
hob bei der Gründungsversammlung des Komitees am 22. Februar
1885 den Zweck des Museums hervor: Er betonte die
Wichtigkeit desselben, „indem es beitragen wird, den Nimbus
und die Ehre der Armee zu verherrlichen, in welcher der
echte alte kaiserliche Geist fortlebt, welche allezeit den
Reichsstandpunkt hochgehalten hat und das Symbol der
Zusammengehörigkeit aller Länder bildet.“ Aus diesem Grunde
hoffte er, „dass das Museum mit der möglichsten
Großartigkeit ins Leben treten möge“.
Das Kuratorium bestand aus:
Kronprinz Rudolf von Österreich, Protektor und Vorsitzender
Erzherzog Wilhelm von Österreich, stellvertretender
Protektor und Vorsitzender
Quirin Ritter von Leitner, damaliger Vorstand des
Hofwaffenmuseums
Alfred Ritter von Arneth, Präsident der kaiserlichen
Akademie der Wissenschaften
Johann Nepomuk Graf Wilczek, Mäzen und Sammler sowie
wichtigster Förderer der seinerzeitigen
Payer-Weyprecht-Expedition.
Neben Ansuchen an diverse Militärinstitutionen, trat man
seitens des Komitees auch an zivile Privatpersonen heran, um
historische Objekte für das neue Museum zu lukrieren. Als
Prinzip galt: Die Sammlungen sollten in Siegestrophäen und
„sonstig historisch interessante Gegenstände ausschließlich
österreichischer Provenienz, welche für die richtige
Erkenntniß der Vergangenheit der k.k. Armee in allen seinen
Factoren Bedeutung haben“ eingeteilt werden. Nur Originale
durften ausgestellt werden, Projekte und Modelle nur unter
besonderen Umständen. Durch die Arbeit des Kuratoriums und
großzügiger Unterstützung des Kaisers, seiner Familie, des
Adels und des Bürgertums sowie des Reichskriegsministeriums
war „eine Fülle von Schätzen zusammengetragen worden, die
sich der heutige Mensch kaum mehr vorstellen kann.“ Am 25.
Mai 1891 schließlich wurde das neue k.u.k. Heeresmuseum im
Arsenal feierlich durch Kaiser Franz Joseph eröffnet und
seiner Bestimmung zugeführt.
Mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges sollte das Museum für
den allgemeinen Besuch unmittelbar geschlossen werden. Die
Gründe hierfür lagen vor allem in dem Umstand, dass von den
verschiedenen Kriegsschauplätzen so viel Material zugewiesen
wurde, dass eine ordnungsgemäße Aufstellung unmöglich wurde.
Das Kriegsende von 1918 bedeutete auch für das Museum
zunächst das vermeintliche Ende. Es lag sogar die Absicht
vor, die Bestände zur Verbesserung der wirtschaftlichen
Notsituation zu verkaufen. Die konnte jedoch abgewendet
werden. Im September 1921 wurde das „Österreichische
Heeresmuseum“ wieder eröffnet. Nunmehr sollte die
Dokumentation der jüngsten militärischen Ereignisses, allen
voran jener des Ersten Weltkrieges, im Vordergrund stehen.
Mit der Eröffnung einer Kriegsbildergalerie 1923 wurde zum
ersten Mal auch der bildenden Kunst ein größerer Bereich
gewidmet. Es waren nun nicht mehr ausschließlich Armeeführer
und Schlachten, die im Vordergrund standen, sondern vor
allem der militärische Alltag im Krieg selbst.
Nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich wurde
das Museum der Dienststelle des Chefs der Heeresmuseen in
Berlin unterstellt und in „Heeresmuseum Wien“ umbenannt.
Während des Zweiten Weltkrieges war das Museum nicht frei
zugänglich und blieb vorwiegend Militärpersonen vorbehalten.
Ab 1943 hatten Zivilisten nur an Wochenenden
Besuchsmöglichkeit. Zu dieser Zeit wurde das Museum primär
für Propagandazwecke genutzt. So wurden etwa Feldzüge der
Wehrmacht in Propaganda-Sonderausstellungen dokumentiert
(„Sieg im Westen“ (Sommer 1940), „Griechenland und Kreta
1941 - Bild und Beute“ (März/Mai 1942) und „Kampfraum
Südost“ (Sommer 1944)).
Mit dem Einsetzen der alliierten Luftangriffe auf Wien ab
Herbst 1943 wurden, wie bei allen Wiener Museen, die
wertvollsten Bestände ausgelagert. Diese Maßnahmen erwiesen
sich auch als zwingend notwendig, denn am 10. September
sowie am 11. Dezember 1944 wurde das Arsenal und der
Südbahnhof von alliierten Bomberverbänden derart stark in
Mitleidenschaft gezogen, dass nicht nur das Museumsgebäude,
sondern auch zahlreiche Depots von Bomben getroffen und
stark beschädigt bzw. zerstört wurden. Gegen Ende des
Krieges, vor allem im Verlauf der so genannten Schlacht um
Wien wurde das Arsenalgelände ebenso schwer in
Mitleidenschaft gezogen.
Während der Besatzungszeit sollten viele der ausgelagerten
Sammlungsobjekte, welche die Kriegswirren überstanden
hatten, von den Alliierten requiriert werden. Vieles sollte
aber auch dem Diebstahl und Plünderungen durch die
Zivilbevölkerung zum Opfer fallen. Trotz der genannten
Schwierigkeiten begann man bereits 1946 mit dem Wiederaufbau
des Museums. Besondere Unterstützung erhielt die damalige
Leitung von der Österreichischen Galerie Belvedere und dem
Kunsthistorischen Museum. Jene vom Technischen Museum zur
Verfügung gestellte Sammlung von Schiffsmodellen, bildet bis
heute das Herzstück des Marinesaales. Am 24. Juni 1955 wurde
das nunmehr in Heeresgeschichtliches Museum umbenannte
Gebäude durch den Bundesminister für Unterricht, Heinrich
Drimmel, feierlich wiedereröffnet.
Weblink:
www.hgm.or.at
Quelle: Dieser Text basiert auf dem Artikel Heeresgeschichtliches_Museum aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons CC-BY-SA 4.0 (Text erweitert). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.
Bilder: Pappenheim, gemeinfrei.
Willkommen
Danke, dass Sie unsere Webseite ausgewählt haben.
Wir freuen uns, Sie hier zu haben und möchten unser Wissen mit Ihnen teilen.
Sie können uns gerne zu verschiedenen Themen unter der Email office@nikles.net schreiben.
Wir antworten in der Regel innerhalb eines Tages.
Die meisten Bilddateien sind aus eigener Quelle und können auf Anfrage kostenlos für eigene Webseiten verwendet werden.
Auf Wunsch auch in höherer Auflösung.
Kontakt
Günter Nikles
Josef Reichl-Str. 17a/7
7540 Güssing
Austria
Email:
office@nikles.net
Website:
www.nikles.net
(c) 2025 www.nikles.net