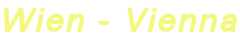13. Bezirk - Lainzer Tiergarten
Der Lainzer Tiergarten ist ein öffentlich zugängliches Naturschutzgebiet in Wien, das von der Magistratsabteilung 49 - Forstamt und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien verwaltet und betreut wird. Er ist ein Tiergarten im Sinne eines weitläufigen Waldgebietes mit reichem, innerhalb des Gartens frei lebendem Wildbestand. Als dieses Schutzgebiet ist es auch Bestandteil des Biosphärenparks Wienerwald.
Lage, Größe, Tore: Der Lainzer Tiergarten, benannt
nach dem östlich anrainenden Ort
Lainz, befindet sich
größtenteils wie dieser in Hietzing,
dem 13. Gemeindebezirk im Westen Wiens, in der
Katastralgemeinde Auhof.
(Ein kleiner Teil im Südwesten des Tiergartens befindet sich
in Niederösterreich bei Laab im Walde.) Das ummauerte Areal
fällt nördlich zum Wiental mit dem Auhof und der
Westautobahn ab, grenzt nördlich und östlich an städtisches
Siedlungsgebiet sowie westlich und südlich an Wald in
Niederösterreich und Wien, südlich auch an das
Liesingbachtal.
Mit den angrenzenden Wäldern zählt der Tiergarten zum
nördlichen Teil des
Wienerwaldes. Er liegt am Ostrand der Alpen, an dem im
Miozän eine Meeresküste lag. Dort wurden auch Hinweise auf
die Tätigkeit eines kleinen Vulkans gefunden, die
wissenschaftlich publiziert wurden. Vulkanische Gesteine (Pikrite,
Tuffe) wurden mehrfach gefunden. An den Gesteinen wurden
Bohrlöcher von Meermuscheln beobachtet.
Die Gesamtfläche des Lainzer Tiergartens beträgt aktuell
2.450 Hektar, wovon 2.360 ha auf Wiener Stadtgebiet liegen.
1.945 Hektar sind Waldfläche. Die Umfassungsmauer des
Lainzer Tiergartens ist zirka 22 Kilometer lang. Der
Eintritt in den Tiergarten ist nur durch je nach Jahreszeit
zu unterschiedlichen Zeiten geöffnete Tore möglich (im
Uhrzeigersinn):
* Lainzer Tor (im Osten; mit Besucherzentrum und naher
Hermesvilla quasi das „Haupttor“ des Tiergartens, ganzjährig
geöffnet; Autobuslinie 60B von
Speising, dort Anschluss an
Straßenbahnlinie 60)
* Gütenbachtor (im Süden) *)
* Laaber Tor (im Südwesten) *)
* Pulverstampftor (im Norden; beim Auhof)
* Nikolaitor (im Nordosten; nahe Bahnhof Wien Hütteldorf, U4 und S-Bahn)
* Sankt Veiter Tor (Autobuslinien 54B und 55B)
(*) mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht zu erreichen
Lainzer Tiergarten, Nikolaitor
Tierbestand, Naturschutz: Der Lainzer Tiergarten
zeichnete sich seit jeher durch Wildreichtum aus (in der
Nachkriegszeit stark dezimiert). Hirsche, Damwild, Rehe,
Europäische Mufflons (gehörnte Wildschafe) und vor allem
Wildschweine gehören zu den vielen dort heimischen
Tierarten. Auch eine große Vielfalt an Fledermäusen wurde
nachgewiesen.
Der ganze Lainzer Tiergarten ist Natura 2000-
Naturschutzgebiet und beherbergt einige der ältesten Buchen
und Eichen im Wienerwald. Stammumfänge von bis zu vier Meter
sind zu finden. Die meisten dieser alten Bäume findet man am
Johannser Kogel. Aufgrund des hohen Wildbestands im Park
findet man sehr viele Viehlägerbiotope, welche sonst sehr
selten sind.
Im Bereich zwischen Lainzer Tor und Hermesvilla befinden
sich Wildgatter und ein Arboretum, in dem viele der heimischen Holzgewächse gezeigt werden.
Der Lainzer Tiergarten ist als einzelnes auch als
Europaschutzgebiet ausgewiesen.
Geschichte: Die ersten Besiedlungen auf dem Areal
des Lainzer Tiergarten gehen auf die Römerzeit zurück. Im
Zuge von archäologischen Ausgrabungen wurden
Keramikbruchstücke, die auf das 2. Jahrhundert n. Chr.
datiert wurden, gefunden. Weitere Funde wurden dem späten
11. bis 13. Jahrhundert zugeordnet. Der Wienerwald wurde
schon im 11. Jahrhundert von den Babenbergern als Jagdgebiet
genutzt.
Kaiser Ferdinand I. kaufte den Auhof mit angrenzenden
Waldungen, ließ 1561 um das Gebiet einen Holzzaun bauen und
machte es zum kaiserlichen Jagdrevier (das es bis 1918
blieb). Der ursprüngliche Zaun umschloss dabei nur einen
kleinen Bereich des heutigen Areals und erforderte immer
wieder intensive Reparaturmaßnahmen.
Gründe für den Zaunbau waren die durch die unmittelbare
räumliche Nähe zu besiedeltem Gebiet auftretenden Probleme
des Verbisses, des Wildwechsels und der Nahrungssuche auf
Äckern und Wiesen sowie die massiven Flurschäden auf den
Agrarflächen der Umgebung. Zudem waren auch der Schutz der
Weingärten und die Trennung der Interessenssphären der Jagd
und der Agrar- und Weinwirtschaft ein Anliegen.
Zur Zeit Kaiser Karls VI. beschreibt eine zeitgenössische
Publikation den Tiergarten als „vornehmsten Wildpark
Europas“. Das Jagdgebiet im Wienerwald wies schon im 18.
Jahrhundert eine gemessen an der natürlichen Population
überdurchschnittlich hohe Wilddichte auf.
Zunehmende Wildschäden in den Weinbergen führten zum Patent
Kaiserin Maria Theresias als Erzherzogin von Österreich vom
25. August 1770, in welchem sie die Haltung von Schwarzwild
nur mehr in geschlossenen Tiergärten erlaubte. Die ersten
Pläne für eine dauerhafte Einfriedung sind auf den 10.
Oktober 1770 datiert.
Unter Kaiser Joseph II. wurde endlich anstelle des
Holzzauns eine Mauer geplant, welche ein viel größeres
Gebiet umfassen sollte. Mit der Errichtung der 24,2 km
langen Steinmauer wurde Baumeister Philipp Schlucker
beauftragt. Dieser hatte sich jedoch bei der Kalkulation der
Baukosten schwer verrechnet und musste die Mauer zwischen
1782 und 1787 um ein Honorar weit unter den tatsächlichen
Kosten fertig stellen. Von dieser Begebenheit soll sich der
Ausspruch „Armer Schlucker“ ableiten. Ein Teil der
originalen Schlucker-Mauer ist direkt neben dem
Pulverstampftor erhalten geblieben.
Das im Zuge der Märzrevolution von 1848 beseitigte
Rechtsinstitut der Grundherrschaft (Hans Kudlichs so
genannte Bauernbefreiung) führte zu diversen
Besitzstreitigkeiten. Der Jahrhunderte lang in kaiserlichem
Privatbesitz gestandene Saugarten, der erst später die
Bezeichnung Tiergarten erhielt, ging am 26. August 1855 auf
Entscheid Franz Josephs I. in hofärarisches Eigentum
(Staatsbesitz, der dem Monarchen zur Nutzung vorbehalten
blieb) über. Das Gebiet wurde weiterhin fast nur zu
Hofjagden der kaiserlichen Familie und ihrer Gäste genutzt.
Hermesvilla: 1882–1886 ließ Franz Joseph I. im stadtnäheren, östlichen
Teil des Tiergartens die Hermesvilla als Refugium für
Kaiserin Elisabeth errichten. Der zur damaligen Zeit, auch
auf Grund von Franz Josephs geringer gewordener Jagdlust,
weniger zum eigentlichen Zweck verwendete Tiergarten wurde
so erstmals anders genutzt. Der Hermesvillapark ist ein bis
heute bestehendes, völlig vom Menschen bepflanztes,
planiertes und gepflegtes Areal, das sich in der botanischen
wie zoologischen Ausstattung stark von der Umgebung
unterscheidet. Die Nutzungskonflikte nach diesem Eingriff in
ein nahezu unbebautes Gebiet blieben nicht aus. So beklagten
sich die Jäger über Wilderei und bezichtigten die
Bauarbeiter der Brandstiftung; die jagd- und
forstwirtschaftlichen Arbeiten ruhten während des
Aufenthalts der Kaiserin im Tiergarten.
Ende der Monarchie, Kriegsgeschädigtenfonds
(1919–1937): Nach dem Zerfall der Monarchie am Ende des
Ersten Weltkriegs, 1918, und damit dem Ende des kaiserlichen
Jagdreviers kam es im Tiergarten zu Wilderei und
Holzakquisitionen, gegen die die verbliebenen Jäger und
Förster vorgingen, allerdings ohne merklichen Erfolg. Auf
Grund des Fehlens der Kohlelieferungen aus dem Ausland war
das Sammeln von „Klaubholz“ eingeschränkt gestattet worden.
Das illegale Holzsammeln und -fällen musste mittels
Gewalteinsatz der Jagd- und Forstbeamten eingedämmt werden.
Auch Baumaterial sowie die Straßenbeleuchtung wurde
entwendet.
Eigentümer des Areals war nun der deutschösterreichische
Staat bzw. die Republik Österreich. Sie übertrug den Lainzer
Tiergarten, wie viele andere ehemalige hofärarische
Besitztümer, am 18. Dezember 1919 an den
Kriegsgeschädigtenfonds (K.G.F.). Diskutierte
Nutzungsänderungen des Tiergartens – so sollte der
Wildbestand auf ein kleines Gehege beschränkt und der Rest
des Waldes an Bauern verpachtet werden, um dem Defizit des
Tiergartens entgegen zu wirken – kamen nicht zu Stande. Auch
eine land- und forstwirtschaftliche Nutzung nach Abschuss
des Wildbestandes wurde überlegt. Die größte Bedrohung für
das heutige Naturschutzgebiet ging von verschiedenen
Bebauungsplänen aus, die nur zu einem kleinen Teil
realisiert wurden: Im stadtnächsten Teil des Areals, an der
Hermesstraße, wurde die Siedlung Friedensstadt errichtet.
(Ecke Hermesstraße / Linienamtsgasse befindet sich bis heute
das einstige Pförtnerhaus des Tiergartens.) Dass der
Tiergarten als solcher weiter bestehen blieb, lag am Fuß
fassenden Naturschutz, der das Ökosystem Lainzer Tiergarten
als schützenswert erachtete.
1919 wurde der Tiergarten für die Öffentlichkeit zeitweilig
zugänglich gemacht. Die Schließzeiten sorgten für
Unverständnis. Obwohl die Anlage nur für die Dauer der
Brunft geschlossen war, fühlten sich die Bürger ungerecht
behandelt und forderten die völlige Öffnung. Das ehemalige
Jagdgebiet wandelte sich langsam zum öffentlichen Park mit
der Möglichkeit zur Tierbeobachtung. Müllprobleme und die
Forderung nach einer Gastwirtschaft auf dem Gelände führten
zu einem intensiven Streit zwischen Naturschützern und
Befürwortern der Kommerzialisierung. Dieser endete 1925 in
einer halbherzigen Erweiterung der „allgemeinen
Forstbeschreibung im Forsteinrichtungswerk“. Schonzeiten für
Wildtiere wurden eingeführt und Flora und Fauna allgemein
besser geschützt.
1927 wurden Teile des Tiergartens zur Errichtung einer
Golfanlage freigegeben, was schwere Konflikte zur Folge
hatte. Die Störung des Wildes, Autoverkehr und die durch das
Wild verursachten Flurschäden sowie die Pläne, Hotels und
Tennisplätze zu errichten, waren die Auslöser. Das Problem
verschwand jedoch von selbst, da der Club mit Geldproblemen
zu kämpfen hatte und schließlich 1938 die Benützung des
Areals gekündigt wurde, obwohl der Golfclub formal auch
während des Krieges bestand.
Großes Aufsehen erregte der Mord, der am 17. Juli 1928 im
Saulackenmais an der Lebedame Katharina Fellner verübt wurde
und als "Mord im Lainzer Tiergarten" in die Wiener Kriminalgeschichte
einging.
Der Kriegsgeschädigtenfonds schaffte es nicht, wie erwartet
Überschüsse zu Gunsten der Kriegsgeschädigten zu erzielen.
Seine Finanzlage war miserabel, sodass der Staat 1929 alle
finanziellen Aufwendungen wie Steuern, Pensionszahlungen
etc. übernahm und der Fonds nur mehr die Bewirtschaftung der
Güter innehatte. Der Fonds erzielte durch kommerzielle Jagd
im Lainzer Tiergarten Einnahmen, wurde aber wegen des durch
intensive Bejagung veränderten Wildverhaltens kritisiert
(„Trophäenschießen“). Die Wirtschaftskrise Anfang der
dreißiger Jahre führte zu so starker Verschuldung des Fonds,
dass er aufgelöst werden musste.
Der Lainzer Tiergarten ging nun wieder in direktes
Staatseigentum über. Die Ständestaatsdiktatur übertrug ihn
1937 ins Eigentum der damals „bundesunmittelbaren“ Stadt
Wien, obwohl das Areal damals noch zum Land Niederösterreich
gehörte.
NS-Ära, Nachkriegszeit (1938–1960): Per 15.
Oktober 1938 wurde von der NS-Diktatur Groß-Wien geschaffen;
der Tiergarten zählte nun zum Stadtgebiet Wiens und befand
sich im neuen 25. Bezirk, Liesing. Unter der Leitung von
Reichsjägermeister Hermann Göring änderte sich die Nutzung
des Gebietes erneut. Einerseits wurde eine intensive
landwirtschaftliche Verwendung der Wiesen in Betracht
gezogen, andererseits wurde der Tiergarten zum
Repräsentationsjagdgebiet der Stadt Wien erklärt und die
forstwirtschaftliche Nutzung stark eingeschränkt. Anders als
in der Lobau wurde im
Tiergarten nur eingeschränkt gejagt. Göring war nur einmal
Jagdgast; die Zucht und „Blutauffrischung“ des Bestandes
standen im Mittelpunkt. Göring regte 1938 an, den Lainzer
Tiergarten zum Naturschutzgebiet zu erklären; dies erfolgte
1941.
Durch Ausdehnung der Landwirtschaft sollten Futtermittel für
die Winterfütterung der Tiere bereitgestellt werden, was
intensive Bodenpflegemaßnahmen, Maschinen und geschultes
Personal erforderte. 1943 wurden Teile der Wiesen zur
Beweidung durch eine Rinderherde freigegeben, auf den
Ackerflächen wurden auch Lebensmittel für die Bevölkerung
angebaut. Während die Landwirtschaft intensiviert wurde,
ging die Holzgewinnung zurück. Die Rückführung der Wälder in
ihren ursprünglichen, für den Wienerwald typischen Charakter
hatte zur Folge, dass die Schlägerungen, vor allem von
Rotbuche, unter das Plansoll der „Reichsstelle für Holz“
fielen. Zu jener Zeit war der Park für die Bevölkerung nur
an Wochenenden zugänglich.
Nach dem Einmarsch der Roten Armee im April 1945 wurde
der Wildbestand nahezu ausgerottet. Die Infrastruktur des
Tiergartens wurde demontiert oder zerstört, vor allem
Buntmetalle galten als Kostbarkeiten. Schießübungen trugen
zur Zerstörung der Landschaft bei. Wegen der
Nahrungsmittelknappheit unmittelbar nach dem Krieg wurde auf
dem Gebiet des Tiergartens wieder mehr Getreide angebaut und
die forstwirtschaftliche Nutzung verstärkt, wobei sich die
Forstverwaltung erfolgreich gegen die Verwendung von
hochwertigem Holz zum Heizen zur Wehr setzte.
1954 wurde NS-Groß-Wien auf das heutige Stadtgebiet
reduziert. Liesing war nun der
23. Bezirk. 1956 wurde der Lainzer Tiergarten aus dem
23.
Bezirk aus- und in den 13. Bezirk,
Hietzing, eingegliedert, dem er bis heute angehört.
Wie nach dem Ersten Weltkrieg wurden in der Nachkriegszeit
andere Nutzungen diskutiert, jedoch nie verwirklicht. Eine
derart große ungenutzte Fläche wurde von vielen als
unnötiger Luxus angesehen, und es gab – wie schon zuvor –
Bestrebungen, das Gebiet zu bebauen. Die Trasse der
Westautobahn sollte nach ursprünglichen Plänen direkt durch
den Tiergarten gelegt werden. Der Streit zwischen
Befürwortern und Gegnern dieser Trassenführung drohte zu
eskalieren, schließlich kam es aber zu einem Kompromiss. Für
den Bau wurden zwar Teile im Norden des Areals bei
Weidlingau
und Auhof abgetrennt, als
Ersatz jedoch 1960 neue Flächen bei Laab im Walde
eingliedert. Diese etwa 90 ha zwischen dem nun
funktionslosen Alten Dianator und dem Laaber Tor befinden
sich in Niederösterreich.
Die Sensibilisierung der Bevölkerung in Naturschutzfragen
führte, von Medien unterstützt, zu stärkerer Kritik an der
Jagd, obwohl die Bejagung eines derartigen Ökosystems für
dessen Bestand unabdingbar ist. Die Gefahren für den
Besucher durch unkontrolliertes Füttern der Wildschweine und
der damit einhergehende Verlust der Scheu der Tiere waren
hingegen kaum Thema.
Mit der Zunahme der Besucherfrequenz stieg der Bedarf an
Rasthäusern: 1959 wurde das „Rohrhaus“, 1963 das „Hirschgstemm“ eröffnet.
Nutzungen und Konflikte in der Gegenwart: Die
heutigen Nutzungsformen im Bereich des Tiergartens
unterscheiden sich beträchtlich von jenen der Gründungszeit.
Nach wie vor ist die Wilddichte im Lainzer Tiergarten hoch
und übersteigt den natürlichen Bestand ca. um den Faktor 10,
was intensive Pflege und Bejagung verlangt, um übermäßigen
Verbiss an den Waldsäumen bzw. Kraut- und Strauchschicht zu
verhindern. Zudem ist das Ansiedeln von Prädatoren aus
Gründen der Sicherheit der Besucher und der beschränkten
Größe des Gebietes unmöglich. Um Gäste des heute
öffentlichen Parks vor möglichen Schädigungen durch die Jagd
zu schützen, wird diese während der Schließzeiten im Winter
durchgeführt. Die dabei bejagten Wildarten sind vor allem
Schwarzwild, aber auch Rotwild und Rehwild. Neben diesen
werden in eigenen Gehegen Damwild, Muffelwild und so
genannte „Auerochsen (Ur)“ gehalten.
In forstwirtschaftlicher Hinsicht steht vor allem die
Erhaltung und Pflege des Bestandes im Vordergrund,
einerseits um die Artendiversität zu erhalten und zu
erweitern, andererseits um die Besucher vor möglichen
Gefahren zu schützen. Das Forstamt der Stadt Wien (MA 49)
ist dabei für alle einschlägigen Arbeiten verantwortlich.
Der Park bietet, botanisch betrachtet, nicht ausschließlich
ursprüngliche, in Mitteleuropa heimische Bepflanzung. Der
Park ist keine Urlandschaft, sondern eine weitgehend der
Natur überlassene Kulturlandschaft. Die Durchforstung wird
im Vergleich zum Nutzwald auf einem sehr geringen Niveau
durchgeführt, abseits der Wege werden die
forstwirtschaftlichen Arbeiten auf ein Minimum reduziert
bzw. ganz eingestellt. Im Bereich des
Johannser Kogels wurde
der – möglicherweise nicht standortspezifische – alte
Eichenbestand trotz Schädigung der Bäume nicht durchforstet
und zum Naturdenkmal erklärt. Um den naturnahen Charakter
des Parks zu fördern, wird die Benützung schwerer
Forstmaschinen so gering wie möglich gehalten.
Auf kleinen Teilen des Gebietes wird Landwirtschaft
betrieben. Von größerer Bedeutung ist jedoch die
Bewirtschaftung der Wiesen. Diese werden einerseits als
Lagerwiesen für die Erholungsnutzung und andererseits als
Futterwiesen, die nicht betreten werden dürfen, ausgewiesen.
Die Zufütterungen während der Wintermonate werden zum
Großteil mit auf diesen Wiesen geerntetem Grünfutter
durchgeführt. Grundsätzlich ist es den Besuchern nur auf
dafür freigegebenen Arealen gestattet, die Wege zu
verlassen.
Hauptsächlich aber wird der Tiergarten heute als
Naherholungsgebiet genutzt. Neben der Hermesvilla als
Kultur- und Ausstellungszentrum ist das Areal vor allem für
Wanderer und Läufer, Familien und Ausflügler interessant.
Auch in der Gegenwart kommt es immer wieder zu
Interessenskonflikten zwischen Besuchern und
Verantwortlichen. Auf der einen Seite ist der Park als
Naturschutzgebiet konzipiert, was durch den möglichst
behutsamen Eingriff in das Ökosystem unterstützt wird,
anderseits ist er ein beliebtes Ausflugsziel und muss damit
Mindestanforderungen an Erreichbarkeit und Infrastruktur
bieten. Die Kombination aus beidem schließt die Möglichkeit
eines naturbelassenen Schutzgebietes im Sinne eines
Nationalparks von vornherein aus, was aber durch die
Jahrhunderte langen Eingriffe in das Ökosystem ohnehin nicht
zur Diskussion steht. Um einen möglich umfassenden Schutz zu
ermöglichen, ist der Lainzer Tiergarten Teil des
Biosphärenparks Wienerwald. Auf Grund der Besucherzahl und
zum Schutz der Besucher sind umfangreiche forst- und
landwirtschaftliche Maßnahmen unvermeidbar, zum Beispiel das
Fällen von morschen Bäumen in der Umgebung der Wege.
Da der Park ein Naturschutzgebiet ist, ist es auf der anderen Seite unmöglich, die infrastrukturellen Maßnahmen soweit auszudehnen, dass der Lainzer Tiergarten zum voll erschlossenen Erholungs- und Vergnügungsgebiet umgewidmet würde, mit allen dazu nötigen Eingriffen. Das Verbot von Kraftfahrzeugen, Fahrrädern, Skateboards und Haustieren, die nur sehr geringen vorhandenen Parkmöglichkeiten, das Verbot von offenem Feuer sowie die eingeschränkte Benützung der Grünflächen sind sicherlich im Vergleich zu anderen Naherholungsgebieten wie dem Wiener Prater oder der Donauinsel eine freizeittechnische Einschränkung. Bis auf die Hermesvilla ist das Gebiet weitgehend unbebaut, die Straßen und Wege sind teilweise unasphaltiert, es stehen relativ wenige sanitäre Einrichtungen zur Verfügung. Diese Einschränkungen machen aber andererseits die spezifische Qualität des Parks aus.
Freizeit: Der Lainzer Tiergarten ist ein beliebtes
Ausflugsziel. Das Areal eignet sich besonders für
Spaziergänge (v. a. Lainzer Tor) und zum Wandern. Auch für
Läufer bzw. Jogger und Nordic Walker ist das gut befestigte
Wegenetz ideal geeignet (teilweise ausgeschilderte
Laufstrecken). Die Einrichtung zweier Naturlehrpfade sowie
die Möglichkeit, an Führungen und Exkursionen unter
fachkundiger Leitung teilzunehmen, erweitert das Angebot.
Ein Besucherzentrum bietet wechselnde Detailausstellungen zu
Aspekten des Naturschutzes im Park.
Die Mitnahme von Hunden in den Lainzer Tiergarten ist wegen des Wildbestandes nicht gestattet.
Der Lainzer Tiergarten ist grundsätzlich täglich ab 8:00 bis
zum Eintritt der Dunkelheit (18:00 bis 21:00 je nach
Jahreszeit) geöffnet; von Anfang November bis gegen Ende
Jänner ist nur der Park der Hermesvilla von 9:00 bis 17:00
zugänglich. (Abweichend davon steht auch während der
Weihnachtsferien der ganze Tiergarten offen, doch sind nur
Lainzer Tor, Nikolaitor und St. Veiter Tor geöffnet.) Der
Eintritt in den Tiergarten (nicht aber in Ausstellungen in
der Hermesvilla) ist frei.
* Gasthäuser: Rohrhaus, Hirschgstemm (Pächter: Rudolf
Wiesinger), Cafe Hermesvilla.
* Museum in der Hermesvilla
* Aussichtsturm Hubertuswarte am
Kaltbründlberg (508 m)
* Nikolaikapelle (erstmals 1321 erwähnt)
* Wienblick Baderwiese
Quelle: Dieser Text basiert auf dem Artikel Lainzer_Tiergarten aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons CC-BY-SA 4.0 (Text erweitert). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.
Bilder: www.nikles.net.
Willkommen
Danke, dass Sie unsere Webseite ausgewählt haben.
Wir freuen uns, Sie hier zu haben und möchten unser Wissen mit Ihnen teilen.
Sie können uns gerne zu verschiedenen Themen unter der Email office@nikles.net schreiben.
Wir antworten in der Regel innerhalb eines Tages.
Die meisten Bilddateien sind aus eigener Quelle und können auf Anfrage kostenlos für eigene Webseiten verwendet werden.
Auf Wunsch auch in höherer Auflösung.
Kontakt
Günter Nikles
Josef Reichl-Str. 17a/7
7540 Güssing
Austria
Email:
office@nikles.net
Website:
www.nikles.net
(c) 2025 www.nikles.net