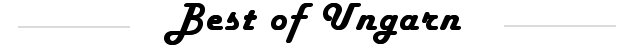Wasser - Rába
Die Rába (deutsch: Raab, slowakisch Rába, slowenisch Raba, lateinisch: Arrabo) ist der drittlängste Fluss Ungarns
und der wichtigste ungarische Nebenfluss der Donau. Die Raab stammt aus Österreich, aus der Steiermark,
aus den Fischbacher Alpen, am Südosthang des Hochlantsch in 1200 m Höhe. In Österreich verläuft sie 95 km in süd-südöstlicher Richtung.
Er erreicht seinen südlichsten Punkt bei Gyanafalva (Jennersdorf) und fließt dann in ost-nordöstlicher Richtung,
um bei Alsószölnök auf einer Höhe von 288 m über dem Meeresspiegel in Ungarn einzutreten.
Von hier aus bildet sie die österreichisch-ungarische Grenze, und ab Rábatótfalu (Szentgotthárd) verläuft sie weiter durch ungarisches Gebiet.
Nach 188 km ab Alsószölnö fließt sie bei Györ in die Mosoni-Duna.
Der Fluss hat eine Gesamtlänge von 283 km, ein Einzugsgebiet von 10 113 km˛ und einen durchschnittlichen Durchfluss von 27 mł/s bei Györ.
Er ist nicht schiffbar, war aber in der Römerzeit ein wichtiger Verkehrsweg. Im Jahr 1896 wurde an der Raab in Ikervár das erste Wasserkraftwerk Ungarns gebaut, das auch heute noch in Betrieb ist. 2009 nahm das fünfte Raab-Kraftwerk, das neben dem Nick-Staudamm errichtete Kenyeri, den Betrieb auf. Die Siedlungen entlang des Flusses beziehen ihr Trinkwasser aus Brunnen an den Ufern der Raab und nutzen das Wasser der Raab auch für die Bewässerung ihrer Felder. Jeden Sommer zieht der Fluss viele Badegäste und Touristen an, die gerne mit dem Boot, Kajak oder Kanu fahren, obwohl die Dämme ohne Schleusenkammern die Arbeit der Bootsfahrer etwas erschweren.
Namensgebung: Sein ungarischer Name leitet sich von seinem lateinischen Namen (Ar(r)abo) keltischen oder illyrischen Ursprungs ab, hinter dessen Wurzel sich das indoeuropäische Adjektiv orob mit seiner dunkelroten, bräunlichen Bedeutung verbergen könnte. Es ist wahrscheinlich slawisch.
Hydrographie: Der Fluss entspringt am Fuße des 1548 Meter hohen Ossers in der Gemeinde Hohenau an der Raab (Teichalm) in der Steiermark/Österreich. Nach 11 km vereinigen sich die beiden Flussarme in Passail auf einer Höhe von 411 m. Der Fluss fließt durch das enge Tal zwischen den Bergen mit einem hohen Gefälle von 89,6 cm/km, selbst an der ungarischen Grenze. Nach dem Verlassen von Körmend wird sie langsamer und schlängelt sich durch das weite Tal der Örség-Hügel. Bei Sárvár erreicht er die Ebene der Raabau (Rábaköz). Das Gefälle nimmt bei Marcalto weiter ab, und bei Györ, wo er in den Mosoni-Duna mündet, beträgt es nur noch 24,1 cm/km.
Ihre Gesamtlänge beträgt 283 km, davon liegen 95 km in Österreich und 188 km in Ungarn. Sein Bett ist bis Csákánydoroszló stark eingebettet, flussabwärts befindet er sich jedoch auf einem Schwemmkegel. Hier wird der ständig mäandrierende Fluss einer intensiven Mäandrierung unterzogen, so dass seine Länge, die durch die Abschnitte Ende des 19. Jahrhunderts erheblich verkürzt wurde, wieder zunimmt. Seine Breite variiert zwischen 30 und 50 Metern entlang der ungarischen Strecke, seine Tiefe (ohne die tieferen Abschnitte oberhalb der Dämme) liegt zwischen 1 und 2,5 Metern, aber in trockenen Jahren ist es nicht ungewöhnlich, dass sich Furtstellen bilden. Bei starken Regenfällen in den Alpen oder bei plötzlicher Schneeschmelze im Frühjahr kann der Wasserspiegel jedoch an einem Tag um bis zu 5 Meter steigen. Im Unterlauf, wenn die Donaudämme hinzukommen, kann der tägliche Anstieg bis zu 7 Meter betragen.
Die Wassergeschwindigkeit der Raab schwankt je nach Niederschlagsmenge und Schneeschmelze zwischen 2 km/h und 11 km/h. Der durchschnittliche Durchfluss an der Mündung beträgt 27 mł/s.
Das Einzugsgebiet des Flusses umfasst die südlichen Hänge der steirischen Alpen, den nördlichen Teil der Örség, die Vasi-Hegyha und die nordwestliche Seite der Kemenesha, das Kemenes-Tal, das Sokoró-Gebirge, die nördlichen Hänge des Keszthely-Plateaus und die nordwestlichen Hänge des Bakony sowie das Kisalföld und das Gebiet des Fertö-Sees. Das gesamte Einzugsgebiet beträgt 10 113 km˛, aber nur etwas mehr als die Hälfte davon, etwa 5 600 km˛, liegt auf ungarischem Gebiet. Das Einzugsgebiet besteht zu 2 % aus Binnengewässern, zu 7 % aus Wiesen, Weiden und Schilf, zu 60 % aus Ackerland und zu 31 % aus Wald.
Die Tierwelt an der Raab: Die Raab, einer der am wenigsten gestörten Flüsse Ungarns, beherbergt zahlreiche Arten. Die Entwicklung der Biota wurde durch die Topographie und das Klima des Gebiets beeinflusst. Er spiegelt alpine, submediterrane und kontinentale Einflüsse wider.
Das im Batthyány-Schloss untergebrachte Raab-Heimatmuseum in Körmend präsentiert in einer Dauerausstellung die Fauna der Raab.
Flora: Zur Flora der Alpokalja gehören der Strauß, die gelbe Lilie und das Schildkraut, die auch entlang der Raab vorkommen.
Unter den Pilzen finden sich in den Auen an vielen Stellen Ackernelken, Parlagiolen, Gartenchampignons, Vogelmiere, Falscher Mehltau, Immergrüner Maipilz, Gelber Knollenblätterpilz und Waldpilze.
Die Ränder der Auenwälder beherbergen eine breite Palette von Moosarten: Buschmoos, Schaummoos, Wachsmoos, Waldmoos usw.
Nieswurz und Farne sind im Rába-Tal ebenfalls allgegenwärtig.
Beispiele für ursprüngliche natürliche Pflanzengesellschaften sind der Eichen-Eschen-Kiefern-Eichen-Hain in der Sárvár-Aue und der Hainbuchen-Eichen-Hain bei Körmend. Im Schlosspark von Körmend gibt es auch Eichen, deren Stämme mehr als 200 Jahre alt sind, und die 2006 abgestorbene Zsennye-Eiche war mit einem Umfang von mehr als 10 Metern wahrscheinlich der älteste und dickste Baum des Landes.
Fauna: Das Flussbett und die Kiesbetten sind reich an Flussmuscheln.
Zu den vorkommenden Insektenarten gehören Borkenkäfer (Schafgarbe, Falter), verschiedene Libellen, Fliegen, Stechmücken, der gestreifte Käfer, die Tauchspinne, verschiedene Blattkäfer, Käfer, Kaulquappen, Schmetterlinge wie der Eulenfalter, die Holzfliege und der Distelfalter, Blattkäfer, Laufkäfer und Zierkäfer.
Unter den Fischen sind Karpfen, Wels, Wiesel, Hecht, Barsch, Zander, Makrele, ungarische und deutsche Brassen und Brachsen zu erwähnen. Es gibt auch Hochland- und Sumpffischarten wie die Zwergbrasse und den Kompost.
Feuchtgebiete sind die Heimat von Frosch- und Molcharten sowie von Reptilien wie Wasserschlangen und Zauneidechsen.
Im Rába-Tal leben mehr als 200 Vogelarten. Flussuferläufer und Watvögel sind auf den Kiesriffen häufig anzutreffen, während in die Wände der abfallenden Ufer gemeißelte Bruthöhlen Kolonien von Wanderfalken und gelegentlich einzelne Eisvögel beherbergen, und Hängevögel nisten in einem sackförmigen Nest, das aus den Flughaaren von Pappeln auf überhängenden Ästen geflochten ist. Der Schwarzspecht ist typisch für die Höhlen, die in die großen Bäume des Küstenwaldes gehauen wurden, aber auch andere Spechtarten leben hier. Die häufigsten Singvögel in den Gebüschen der Strandränder sind die Feldgrille, die Nachtigall und der Trauerschnäpper, während in den mit Brennnesseln gesäumten Bereichen der Teichrohrsänger und der Gänsesäger die häufigsten Singvögel sind. Unter den Greifvogelarten sind der Gänsesäger, der Habicht und der Turmfalke am häufigsten, während der Waldkauz und der Steinkauz am häufigsten vorkommen.
Die Zahl der Säugetierarten übersteigt dreißig. Außerdem gibt es zwei große Nagetiere, die an die aquatische Umwelt angepasst sind: die Bisamratte und der Biber sowie der Fischotter, der sich von Fischen ernährt. Weitere häufige Arten sind der Hase, der Marder, das Wiesel, das Hermelin, der Dachs und das Eichhörnchen. Nachtaktive Fledermäuse erscheinen oft schon vor der Dämmerung an ihren Trinkplätzen oberhalb des Flusses.
Zu den in unserem Land heimischen Großwildarten gehören Rehe, Hirsche und Wildschweine.
Geschichte: Die Entstehung der Raab geht auf die Zeit vor 3 Millionen Jahren zurück, als die Donau das Gebiet verließ. Auf einer Karte von Pannonien aus dem 2. Jahrhundert von Claudius Ptolemäus mündet die nordöstliche Raab bei /ARABON.FLV. BREGAETIUM in die Donau.
Aus den Dokumenten des 14. bis 15. Jahrhunderts lässt sich die Richtung der Raab anhand der betreffenden Siedlungen eindeutig bestimmen. Diese Siedlungen liegen teilweise entlang des Hauptarms: Iwanch (1346), Rum (1350), Hydwegh (1372), Uyfalua (1429), Azzonfalua (1451), Papuch/Ekl (1367), Marzalthew (1469), Malomsok (1474), Moruchyda (1287) - und in der Raabau (Rábaköz) - Vycha (1360), Vadosfalua (1428), Myhaly (1429), Kysfalud (1433), Petlend (1317), Chanyk (1436). Der Grund dafür ist, dass sich der Fluss Rába im Gebiet von Nick verzweigte und in mehreren Armen nach Norden in das Tal der Rába floss und in Richtung des heutigen Hauptarms floss.
Ein Flussarm, der durch das Raabtal fließt, wird in einem Privileg von Andreas II. von Ungarn aus dem Jahr 1233 als Rabche bezeichnet, während derselbe Flussarm laut einer Erklärung der Adligen von Mihályi aus dem Jahr 1377 als Raba bezeichnet wird. Nach einem Zeugnis der Adligen von Mihályi aus dem Jahr 1429 befanden sich die Mühlen in den Besitzungen von Myhaly und Lynkohath an der Rába, die auch als Baluanus und Luas bezeichnet wurde.
Die westlicheren Flüsse Baluanus/Baluanus und die östlicheren Flüsse Lusa/Luas werden bereits in früheren Urkunden im Gebiet der heutigen Kleinen Raab erwähnt. Heute trennt sich die Kis-Rába bei Nick von der Rába und fließt jenseits von Kapuvár als Rábca weiter und vereinigt sich mit der Répce.
Frühe Karten von Ungarn aus dem 16. Jahrhundert zeigen praktisch die gleiche Situation. Auf der Karte des Komitats Sopron von 1811 ist ein weiterer Nebenfluss eingezeichnet, der zwischen Edve und Vág abzweigt, sich dann teilt und nach Norden fließt.
Die Nebenflüsse auf der rechten Seite der Raab - Pápoc, Marcal, Mórichida - werden gemeinhin als Mezeuraba/Mezorába bezeichnet. Ein anderer Name, der in den Dokumenten des Komitats Eisen häufig verwendet wird, ist sylva Raba/Rába forest, der sich auf die großen Wälder in der Flussaue bezieht. In einer Urkunde Ludwigs I. aus dem Jahr 1350 wird ein "várnagy" (Burgwächter) genannter Ort am Fluss Rába in Vasvár erwähnt.
Der heutige Zustand des Flusses ist das Ergebnis von Regulierungsarbeiten, die im frühen 17. Jahrhundert stattfanden.
Quelle: Text: Wikipedia (erweitert), Bilder: www.nikles.net und Google Maps.
Er ist nicht schiffbar, war aber in der Römerzeit ein wichtiger Verkehrsweg. Im Jahr 1896 wurde an der Raab in Ikervár das erste Wasserkraftwerk Ungarns gebaut, das auch heute noch in Betrieb ist. 2009 nahm das fünfte Raab-Kraftwerk, das neben dem Nick-Staudamm errichtete Kenyeri, den Betrieb auf. Die Siedlungen entlang des Flusses beziehen ihr Trinkwasser aus Brunnen an den Ufern der Raab und nutzen das Wasser der Raab auch für die Bewässerung ihrer Felder. Jeden Sommer zieht der Fluss viele Badegäste und Touristen an, die gerne mit dem Boot, Kajak oder Kanu fahren, obwohl die Dämme ohne Schleusenkammern die Arbeit der Bootsfahrer etwas erschweren.
Namensgebung: Sein ungarischer Name leitet sich von seinem lateinischen Namen (Ar(r)abo) keltischen oder illyrischen Ursprungs ab, hinter dessen Wurzel sich das indoeuropäische Adjektiv orob mit seiner dunkelroten, bräunlichen Bedeutung verbergen könnte. Es ist wahrscheinlich slawisch.
Hydrographie: Der Fluss entspringt am Fuße des 1548 Meter hohen Ossers in der Gemeinde Hohenau an der Raab (Teichalm) in der Steiermark/Österreich. Nach 11 km vereinigen sich die beiden Flussarme in Passail auf einer Höhe von 411 m. Der Fluss fließt durch das enge Tal zwischen den Bergen mit einem hohen Gefälle von 89,6 cm/km, selbst an der ungarischen Grenze. Nach dem Verlassen von Körmend wird sie langsamer und schlängelt sich durch das weite Tal der Örség-Hügel. Bei Sárvár erreicht er die Ebene der Raabau (Rábaköz). Das Gefälle nimmt bei Marcalto weiter ab, und bei Györ, wo er in den Mosoni-Duna mündet, beträgt es nur noch 24,1 cm/km.
Ihre Gesamtlänge beträgt 283 km, davon liegen 95 km in Österreich und 188 km in Ungarn. Sein Bett ist bis Csákánydoroszló stark eingebettet, flussabwärts befindet er sich jedoch auf einem Schwemmkegel. Hier wird der ständig mäandrierende Fluss einer intensiven Mäandrierung unterzogen, so dass seine Länge, die durch die Abschnitte Ende des 19. Jahrhunderts erheblich verkürzt wurde, wieder zunimmt. Seine Breite variiert zwischen 30 und 50 Metern entlang der ungarischen Strecke, seine Tiefe (ohne die tieferen Abschnitte oberhalb der Dämme) liegt zwischen 1 und 2,5 Metern, aber in trockenen Jahren ist es nicht ungewöhnlich, dass sich Furtstellen bilden. Bei starken Regenfällen in den Alpen oder bei plötzlicher Schneeschmelze im Frühjahr kann der Wasserspiegel jedoch an einem Tag um bis zu 5 Meter steigen. Im Unterlauf, wenn die Donaudämme hinzukommen, kann der tägliche Anstieg bis zu 7 Meter betragen.
Die Wassergeschwindigkeit der Raab schwankt je nach Niederschlagsmenge und Schneeschmelze zwischen 2 km/h und 11 km/h. Der durchschnittliche Durchfluss an der Mündung beträgt 27 mł/s.
Das Einzugsgebiet des Flusses umfasst die südlichen Hänge der steirischen Alpen, den nördlichen Teil der Örség, die Vasi-Hegyha und die nordwestliche Seite der Kemenesha, das Kemenes-Tal, das Sokoró-Gebirge, die nördlichen Hänge des Keszthely-Plateaus und die nordwestlichen Hänge des Bakony sowie das Kisalföld und das Gebiet des Fertö-Sees. Das gesamte Einzugsgebiet beträgt 10 113 km˛, aber nur etwas mehr als die Hälfte davon, etwa 5 600 km˛, liegt auf ungarischem Gebiet. Das Einzugsgebiet besteht zu 2 % aus Binnengewässern, zu 7 % aus Wiesen, Weiden und Schilf, zu 60 % aus Ackerland und zu 31 % aus Wald.
Die Tierwelt an der Raab: Die Raab, einer der am wenigsten gestörten Flüsse Ungarns, beherbergt zahlreiche Arten. Die Entwicklung der Biota wurde durch die Topographie und das Klima des Gebiets beeinflusst. Er spiegelt alpine, submediterrane und kontinentale Einflüsse wider.
Das im Batthyány-Schloss untergebrachte Raab-Heimatmuseum in Körmend präsentiert in einer Dauerausstellung die Fauna der Raab.
Flora: Zur Flora der Alpokalja gehören der Strauß, die gelbe Lilie und das Schildkraut, die auch entlang der Raab vorkommen.
Unter den Pilzen finden sich in den Auen an vielen Stellen Ackernelken, Parlagiolen, Gartenchampignons, Vogelmiere, Falscher Mehltau, Immergrüner Maipilz, Gelber Knollenblätterpilz und Waldpilze.
Die Ränder der Auenwälder beherbergen eine breite Palette von Moosarten: Buschmoos, Schaummoos, Wachsmoos, Waldmoos usw.
Nieswurz und Farne sind im Rába-Tal ebenfalls allgegenwärtig.
Beispiele für ursprüngliche natürliche Pflanzengesellschaften sind der Eichen-Eschen-Kiefern-Eichen-Hain in der Sárvár-Aue und der Hainbuchen-Eichen-Hain bei Körmend. Im Schlosspark von Körmend gibt es auch Eichen, deren Stämme mehr als 200 Jahre alt sind, und die 2006 abgestorbene Zsennye-Eiche war mit einem Umfang von mehr als 10 Metern wahrscheinlich der älteste und dickste Baum des Landes.
Fauna: Das Flussbett und die Kiesbetten sind reich an Flussmuscheln.
Zu den vorkommenden Insektenarten gehören Borkenkäfer (Schafgarbe, Falter), verschiedene Libellen, Fliegen, Stechmücken, der gestreifte Käfer, die Tauchspinne, verschiedene Blattkäfer, Käfer, Kaulquappen, Schmetterlinge wie der Eulenfalter, die Holzfliege und der Distelfalter, Blattkäfer, Laufkäfer und Zierkäfer.
Unter den Fischen sind Karpfen, Wels, Wiesel, Hecht, Barsch, Zander, Makrele, ungarische und deutsche Brassen und Brachsen zu erwähnen. Es gibt auch Hochland- und Sumpffischarten wie die Zwergbrasse und den Kompost.
Feuchtgebiete sind die Heimat von Frosch- und Molcharten sowie von Reptilien wie Wasserschlangen und Zauneidechsen.
Im Rába-Tal leben mehr als 200 Vogelarten. Flussuferläufer und Watvögel sind auf den Kiesriffen häufig anzutreffen, während in die Wände der abfallenden Ufer gemeißelte Bruthöhlen Kolonien von Wanderfalken und gelegentlich einzelne Eisvögel beherbergen, und Hängevögel nisten in einem sackförmigen Nest, das aus den Flughaaren von Pappeln auf überhängenden Ästen geflochten ist. Der Schwarzspecht ist typisch für die Höhlen, die in die großen Bäume des Küstenwaldes gehauen wurden, aber auch andere Spechtarten leben hier. Die häufigsten Singvögel in den Gebüschen der Strandränder sind die Feldgrille, die Nachtigall und der Trauerschnäpper, während in den mit Brennnesseln gesäumten Bereichen der Teichrohrsänger und der Gänsesäger die häufigsten Singvögel sind. Unter den Greifvogelarten sind der Gänsesäger, der Habicht und der Turmfalke am häufigsten, während der Waldkauz und der Steinkauz am häufigsten vorkommen.
Die Zahl der Säugetierarten übersteigt dreißig. Außerdem gibt es zwei große Nagetiere, die an die aquatische Umwelt angepasst sind: die Bisamratte und der Biber sowie der Fischotter, der sich von Fischen ernährt. Weitere häufige Arten sind der Hase, der Marder, das Wiesel, das Hermelin, der Dachs und das Eichhörnchen. Nachtaktive Fledermäuse erscheinen oft schon vor der Dämmerung an ihren Trinkplätzen oberhalb des Flusses.
Zu den in unserem Land heimischen Großwildarten gehören Rehe, Hirsche und Wildschweine.
Geschichte: Die Entstehung der Raab geht auf die Zeit vor 3 Millionen Jahren zurück, als die Donau das Gebiet verließ. Auf einer Karte von Pannonien aus dem 2. Jahrhundert von Claudius Ptolemäus mündet die nordöstliche Raab bei /ARABON.FLV. BREGAETIUM in die Donau.
Aus den Dokumenten des 14. bis 15. Jahrhunderts lässt sich die Richtung der Raab anhand der betreffenden Siedlungen eindeutig bestimmen. Diese Siedlungen liegen teilweise entlang des Hauptarms: Iwanch (1346), Rum (1350), Hydwegh (1372), Uyfalua (1429), Azzonfalua (1451), Papuch/Ekl (1367), Marzalthew (1469), Malomsok (1474), Moruchyda (1287) - und in der Raabau (Rábaköz) - Vycha (1360), Vadosfalua (1428), Myhaly (1429), Kysfalud (1433), Petlend (1317), Chanyk (1436). Der Grund dafür ist, dass sich der Fluss Rába im Gebiet von Nick verzweigte und in mehreren Armen nach Norden in das Tal der Rába floss und in Richtung des heutigen Hauptarms floss.
Ein Flussarm, der durch das Raabtal fließt, wird in einem Privileg von Andreas II. von Ungarn aus dem Jahr 1233 als Rabche bezeichnet, während derselbe Flussarm laut einer Erklärung der Adligen von Mihályi aus dem Jahr 1377 als Raba bezeichnet wird. Nach einem Zeugnis der Adligen von Mihályi aus dem Jahr 1429 befanden sich die Mühlen in den Besitzungen von Myhaly und Lynkohath an der Rába, die auch als Baluanus und Luas bezeichnet wurde.
Die westlicheren Flüsse Baluanus/Baluanus und die östlicheren Flüsse Lusa/Luas werden bereits in früheren Urkunden im Gebiet der heutigen Kleinen Raab erwähnt. Heute trennt sich die Kis-Rába bei Nick von der Rába und fließt jenseits von Kapuvár als Rábca weiter und vereinigt sich mit der Répce.
Frühe Karten von Ungarn aus dem 16. Jahrhundert zeigen praktisch die gleiche Situation. Auf der Karte des Komitats Sopron von 1811 ist ein weiterer Nebenfluss eingezeichnet, der zwischen Edve und Vág abzweigt, sich dann teilt und nach Norden fließt.
Die Nebenflüsse auf der rechten Seite der Raab - Pápoc, Marcal, Mórichida - werden gemeinhin als Mezeuraba/Mezorába bezeichnet. Ein anderer Name, der in den Dokumenten des Komitats Eisen häufig verwendet wird, ist sylva Raba/Rába forest, der sich auf die großen Wälder in der Flussaue bezieht. In einer Urkunde Ludwigs I. aus dem Jahr 1350 wird ein "várnagy" (Burgwächter) genannter Ort am Fluss Rába in Vasvár erwähnt.
Der heutige Zustand des Flusses ist das Ergebnis von Regulierungsarbeiten, die im frühen 17. Jahrhundert stattfanden.
Quelle: Text: Wikipedia (erweitert), Bilder: www.nikles.net und Google Maps.

Csákánydoroszló, Rába
Die Raab bei Csákánydoroszló an der Straße 7451 in Ungarn.
Foto: www.nikles.net
Foto: www.nikles.net

Csákánydoroszló, Rába
Die Raab bei Csákánydoroszló an der Straße 7451 in Ungarn.
Foto: www.nikles.net
Foto: www.nikles.net
Disclaimer
Danke, dass Sie unsere Webseite ausgewählt haben. Wir freuen uns, Sie hier zu haben und möchten unser Wissen mit Ihnen teilen. Sie können uns gerne zu verschiedenen Themen unter der Email office@nikles.net schreiben. Wir antworten in der Regel innerhalb eines Tages.
Die meisten Bilddateien sind aus eigener Quelle und können auf Anfrage kostenlos für eigene Webseiten verwendet werden. Auf Wunsch auch in höherer Auflösung.
Kontakt
Bevorzugte Kontaktaufnahme ist Email.
Email:
office@nikles.net
Website:
www.nikles.net
Günter Nikles,
Josef Reichl-Straße 17a/7,
A-7540 Güssing
Österreich